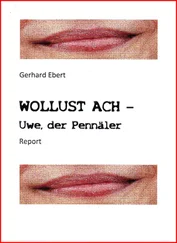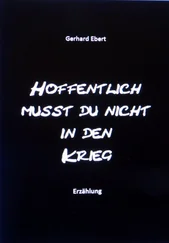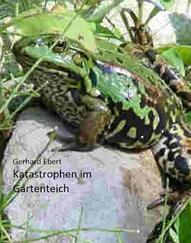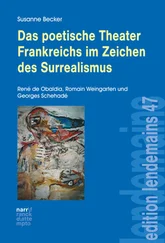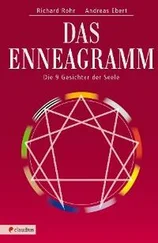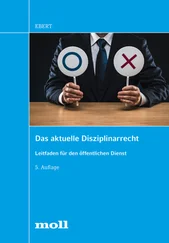1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Kühn benutzt seinen theatralischen Einfall also, um den Nachweis zu führen, daß sich der Faschismus in Westdeutschland völlig legal neu konstituiert. Das ist denn freilich von bestürzender Aktualität. Fernab ästhetischer Erwägungen wird klar: Es wäre eine Tragödie für das deutsche Volk, gelänge es nicht, den Faschisten und Militaristen das schmutzige Handwerk zu legen. Das Stück Kühns ist noch aus anderem Grunde wertvoll. Es zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen dramatischen Werken dieser Spielzeit. Kühn ist talentiert. Seine Dialoge fordern die Geste heraus, sie sind knapp, gut durchdacht und von geistiger Spannkraft. Die Szene zwischen dem Juden Fisch und dem geschäftstüchtigen Nazi Schönfelder zum Beispiel ist dramaturgisch meisterhaft gestaltet. In Karl-Marx-Stadt, wo ich das Stück sah, war deutlich zu spüren, daß sich das ganze Ensemble für dieses Werk entschieden hatte. Unter der Regie von Wolfgang Keymer wurde vorzüglich gespielt. Ein wenig mehr gestische Präzision beim Profilieren der Figuren, ein wenig mehr kritische Schärfe, und die Aufführung würde sogar Glanz bekommen. Den kleinen Gauner Block gibt Wolfgang Sasse, die Komplizin Amelia unausgeglichen Christine Schwarze und den großen Gauner Wülfing Peter Harzheim. In vortrefflicher Studie Julius Klee als David Fisch. Dem Stück sind viele Inszenierungen zu wünschen.
SONNTAG, 28. Februar 1960
von Friedrich Schiller,
Maxim Gorki Theater Berlin,
Regie: Maxim Vallentin und Hans Dieter Mäde
Schillers „Räuber“
Maxim Vallentin und Hans Dieter Mäde haben im Berliner Maxim Gorki Theater „Die Räuber" neu inszeniert. Das Publikum wird aufgerüttelt vom Ruf nach der Republik und kostet bis zur Neige aus das Scheitern des „hochherzigen Jünglings" Karl; es wird abgestoßen vom Ruf nach Unterdrückung und verfolgt erregt das Ende des zynischen Menschenverächters Franz.
Jedoch: Das Haus setzt der Aufführung eigenwillige Grenzen. Diese Bühne kann den Blick nicht freigeben auf die Böhmischen Wälder. Ein kümmerlicher, stilisierter Baum vor tristem Hintergrund ersetzt nicht, was zur Urwüchsigkeit der „Räuber"-Szene gehört. Die Räuber brauchen Raum für ihre Aktionen. Hier ist er nicht. So können die Regisseure ihre Konzeption nicht ausleben. Wider Willen werden sie in die Defensive gedrängt. Diese Kammerspielbühne ist adäquat allein für die Szenen im Schloß. Und jener Streit zwischen Amalia und Franz, den Amalia mit der Vertreibung Franzens beendet, ist dann auch auffallend dicht. Filigranarbeit.
Sabine Krug gibt der Amalia edle Substanz, aufgeklärten Geist und eine reine Seele. Eine geschlossene Darstellung. Helmut Müller-Lankows Franz ist eher ein rustikaler Bastard, denn ein aristokratischer Nachkomme des alten Moor. Müller-Lankow agiert ohne Kulissen-Verschlagenheit, aber zuweilen mit aufdringlicher Lautstärke. Wenn er schreit, verliert er an Ausdruck. Ein Aristokrat ist der Karl Moor Albert Hetterles. Er ist kein Schauspieler der Explosivität. Sein Karl wird von den Ereignissen mehr gedrängt, als daß er sie mit vorantreibt; er gibt einen Karl des späten, nicht des Schillers der Karlsschule. Aber das liegt auch an der Regie, die in dem Streben nach literaturhistorischer Gültigkeit die Schillersche Urwüchsigkeit, das frische Pathos rebellischen Anspruchs und Aufbruchs um Nuancen aus dem Auge verloren hat.
In den weiteren Rollen fällt Walter Jupe als Spiegelberg auf. Dieser kleine Existenzphilosoph mit Angst in den Hosen und Unsinn auf der Zunge intrigiert sich durch die Szene, daß seine modernen Nachkommen noch was lernen könnten. Jochen Thomas als Schweizer ist wieder einmal ein braver, treuherziger Kerl ohne Tadel, seine Affekte freilich bleiben hausbacken gewollt, ohne volkstümliches, ursprüngliches und mitreißendes Temperament; Willi Narloch spielt den Pater mit ernster, gemessener Manier; Kurt Steingraf gibt den Maximilian anfangs so rüstig, daß Franz offenbar auch hinter der Szene tätig ist, um seinen Vater dann doch noch schön mürbe zu kriegen.
SONNTAG, 31. Juli 1960
von Erwin Strittmatter,
Uraufführung des Deutschen Theaters im Berliner Ensemble,
Regie: Benno Besson
„Die Holländerbraut“
Diese Premiere des Deutschen Theaters im Berliner Ensemble haben wir nachdenklich verlassen. In die Freude über das neue Werk Strittmatters mischten sich Überlegungen ästhetischer Art. Das Bild, das uns der Dichter entwirft, ist wahr. Gutsarbeiter und Tagelöhner nehmen 1945 ihre Geschicke in die eigenen Hände. Sie errichten Neubauernhöfe aus Lehm und führen den Klassenkampf gegen Großbauern und Unternehmer. Am Tage arbeiten sie, in der Nacht studieren sie. Der Kampf ist schwer, aber siegreich. Denn es gibt die Partei, die Partei der Arbeiterklasse. Und die Genossen, eben aus dem KZ entlassen, stehen ihren Mann. Strittmatter gibt wie in „Katzgraben" einen Querschnitt durch die sozialen Schichten des Dorfes. Er stellt uns die unterschiedlichsten Charaktere vor, plastisch und rund wie in seinen Romanen. Da treibt die Idiotin Schnurfarski ihr Unwesen, da kommt die alte Feimer, das Kräuterweib, mit der Zeit nicht mehr zurecht, da künden Kinder den neuen Tag an. Leben in Hülle und Fülle. Dennoch kann das Stück nicht restlos überzeugen.
Wir wissen, das dramatische Gebiet, das wir betreten, ist Neuland, ist nicht mit Verkehrszeichen versehen. Unser Kompaß, die marxistische Ästhetik, gibt die Richtung an. Aber Sackgassen sind nicht markiert, Hauptstraßen nicht gekennzeichnet. Einzelne können irren. Prüfen wir jeden Schritt. Nur gemeinsam kommen wir voran. Beträchtlichen Boden haben wir gewonnen mit Sakowskis „Die Entscheidung der Lene Mattke". Weiter gekommen sind wir durch die Autoren Hauser, Zinner, Baierl, Hacks, Müller, Richter, Heller/Gruchmann-Reuter, Pfeiffer. Nun Erwin Strittmatter. Sein Stück ist ein mutiger Versuch. Er stößt uns mitten hinein in die Diskussion um unsere neue sozialistische Dramatik.
Die Problematik des Stückes ist zwar die Problematik des in erster Linie epischen Dichters Strittmatter. Es ist aber gleichzeitig die aller unserer suchenden Dramatiker. Sie können den neuen Inhalt nicht bewältigen ohne das tiefe Verständnis für die Funktion der dramatischen Form. Und die Form muß unzulänglich sein, wenn der Inhalt nicht bis ins Letzte parteilich durchdacht ist.
Strittmatter wollte zeigen, daß private Entscheidungen eines Menschen stets zugleich gesellschaftliche Entscheidungen sind. Duldung des Klassengegners aus privater Rücksicht, zum Beispiel aus Liebe, ermutigt ihn; Entlarvung trotz persönlicher Bindungen wirft ihn zurück. Der Autor entwickelte seine Gedanken an dem Schicksal der Tagelöhnerin Hanna Tainz. Das Mädel liebt 1944 den Großgrundbesitzerssohn und Leutnant der faschistischen Wehrmacht Heinrich Erdmann. Sie bekommt ein Kind. Er gibt an, sie mit einem holländischen Zwangsarbeiter gesehen zu haben. Sie wird ins KZ verschleppt. Dort prügelt man ihr das Kind ab. Nach 1945 wird sie Bürgermeisterin im Heimatdorf. Man nennt sie dort noch immer „Holländerbraut". Heinrich Erdmann nähert sich ihr wieder. Er gibt vor, sich zu bessern. Sie verlangt Beweise. Damit er es beweisen kann, erreicht sie mit Hilfe der Genossen, daß er Neubauer wird. Um sie sich endlich gefügig zu machen, nimmt er Hanna mit Gewalt. Wieder bekommt sie ein Kind. Jetzt will sie es nicht, aber er. Sie gerät in Abhängigkeit von ihm, sucht nicht die Hilfe der Partei. Sie wird ausgeschlossen. Er wird dreist, sabotiert die Getreideablieferung. Es kommt zum Tumult, wohl gesteuert von ihm und einem Bauunternehmer. Endlich entlarvt Hanna den Erdmann.
Das ist auf den ersten Blick ein bewegtes Geschehen. Und doch bleiben wir seltsam unbewegt. Warum? Hanna ist eine Vertreterin der bis 1945 ausgebeuteten Arbeiterklasse. Das sollte sie uns liebenswert machen. Aber sie verficht nur ihre Privatangelegenheit. Dem Vater gegenüber setzt sie ihre eigenwillige Liebe durch. Dann ist sie Objekt des Geschehens. Nach 1945 lernt sie, daß, damit der Mensch gut sei, die Macht der Begüterten gebrochen werden muß. Dennoch bringt sie den Erdmann wieder ins Spiel. Aus Liebe? Das bleibt offen. Sie wird wieder zum Objekt des Geschehens, verurteilt sich selbst zur Passivität. Aus Liebe? Offenbar ja. Denn sie läßt Erdmann gewähren. Als sie endlich parteilich handelt, endet das Stück. Strittmatter bittet am Schluß um Liebe und Verständnis für eine Frau, von deren Art es viele gegeben haben mag. Aber unser künstlerisches Interesse hat sie sich nicht erkämpft. Denken wir an Lene Mattke!
Читать дальше