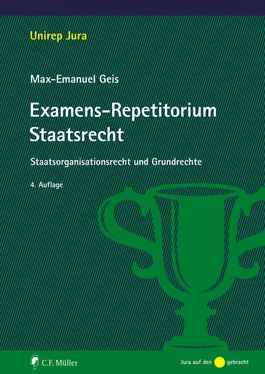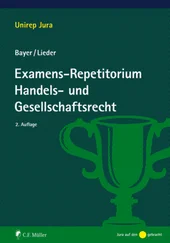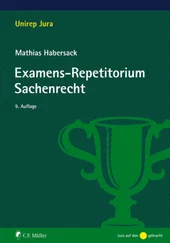1 ...6 7 8 10 11 12 ...28 28
Die Schulversammlung ist der Zusammenschluss einer kleineren Gesamtheit von Staatsbürgern. Demokratische Legitimation kann jedoch nur durch das gesamte Staatsvolk erfolgen. Mit einem „Teilvolk“, das ausnahmslos alle Personen in einem definierten Gebiet erfasst, wie es auf Gemeinde- oder Kreisebene besteht, ist die Schulversammlung nicht vergleichbar.[51] Die Schulversammlung ist ein Verbund, der aus Eltern- und Schülervertretern besteht und seine Legitimation nur von diesen bestimmten Gruppen erhält. Eine derartige „Teilvolk-Legitimation“ ist jedoch nicht ausreichend.[52] Amtsträger – darunter fallen auch Schulleiter – erfahren ihre demokratische Legitimation ebenfalls durch das Volk oder durch demokratisch legitimierte Staatsorgane.[53] Der Zurechnungszusammenhang i.R.d. Legitimationskette kann nur über das Gesamtvolk im Bereich des Bundeslandes X (Art. 28 I 2, Art. 20 II GG) hergestellt werden. Einem Teilvolk, das nur durch einen örtlichen oder sonstigen speziellen Bezug gesetzlich verbunden ist, kann diese Legitimationskraft nicht zugestanden werden. Die Größe der Schulversammlung ist nicht maßgeblich, soweit sie nicht die Gesamtheit des Bundeslandes X ausmacht. Auch eine reine Betroffenenpartizipation reicht für die demokratische Legitimation nicht aus.[54] Damit ist festzuhalten, dass die Schulversammlung keine ausreichende demokratische Legitimation aufweist. Folglich verstößt § 3 gegen das Demokratieprinzip (Art. 20 I, II, 28 I 2 GG).
bb) Die Schulversammlung als Element funktionaler Selbstverwaltung
29
Möglicherweise könnte die Schulversammlung als Organ funktionaler Selbstverwaltung legitimiert sein. Die Legitimationsform hierfür stellt nicht auf das Gesamtvolk, sondern auf Interessen- und Mitgliedergemeinschaften ab. Abzugrenzen ist diese von der kommunalen Selbstverwaltung, die den Volksteil gebietsbezogen auf Gemeinde- und Kreisebene (Art. 28 I 2 GG) demokratisch legitimiert. Im Gegensatz dazu ist die funktionale Selbstverwaltung als sachlich-inhaltliche Legitimation aufgabenbezogen.[55] Diese Legitimation wurzelt nicht im Demokratieprinzip, sondern im Interesse an einer möglichst optimierten Entscheidungsfindung durch Einbeziehung des Sachverstandes betroffener Gruppen (z.B. Berufskammern und Universitäten), die ansonsten nicht zur demokratischen Legitimation berechtigt wären.[56] Allerdings besteht dabei ein Defizit in der personell-demokratischen Legitimation. Daher sind zum Ausgleich eine staatliche Aufsicht und eine gesetzliche oder verfassungsrechtliche Rechtfertigung unabdingbar, um das erforderliche „Legitimationsniveau“ zu erhalten. Dieses ist nur gewahrt, wenn für jede staatliche Handlung auch ein Subjekt „greifbar ist“, das gegenüber dem Bürger verantwortlich ist – und sei es in der Wahlentscheidung.[57] Demokratische Legitimation und demokratische Verantwortlichkeit bilden eine untrennbare Einheit.
30
Das vorgesehene Organ einer Schulversammlung ist aber nicht mit einer aufgabenbezogenen, im Grundrechtsschutz durch Organisation und Verfahren legitimierten, funktionalen Selbstverwaltung zu vergleichen. Es fehlt schon äußerlich an der körperschaftlichen Organisation der Betroffenen oder jedenfalls an einer sonstigen juristischen Person des öffentlichen Rechts als Rechtsträger (Schulen sind regelmäßig unselbstständige Anstalten des öffentlichen Rechts). Darüber hinaus bestehen keine gemeinsamen Interessen, die für eine optimierte Entscheidungsfindung notwendig sind. Während die Lehrerschaft die öffentlichen Interessen des Staates repräsentiert (staatlicher Erziehungsauftrag abgeleitet aus Art. 7 I GG), nehmen die Eltern und Schüler private Interessen wahr (privater Erziehungsauftrag abgeleitet aus Art. 6 I GG, Ausbildungsfreiheit aus Art. 12 I GG). Es besteht also ein Interessensgegensatz,[58] was insbesondere aus Art. 7 I GG ersichtlich wird. Eine originäre Legitimation im Rahmen funktionaler Selbstverwaltung ist mithin nicht gegeben.
cc) Partizipationsrechte neben demokratischer Legitimation
31
Der Schulversammlung könnten Beteiligungsrechte zustehen. Die Entscheidungsgewalt der demokratisch legitimierten Mitglieder darf dadurch aber nicht eingeschränkt werden.[59] Um dies sicherzustellen, unterliegt die Mitbestimmung der nicht ausreichend demokratisch legitimierten Mitglieder sowohl einer Schutzzweckgrenze als auch einer Verantwortungsgrenze.[60] Während die Schutzzweckgrenze von den Interessen der Amtsträger bestimmt wird, steht aufgrund der Verantwortungsgrenze den verantwortlichen Verwaltungsträgern eine Letztentscheidungskompetenz zu.[61] Handelt es sich um einen Amtsauftrag, wie den staatlichen Schulauftrag,[62] so kommen diese Sicherungsmechanismen zur Anwendung. Die Reichweite der Partizipationsrechte bestimmt sich nach der Intensität und Nachhaltigkeit, mit welcher die Interessen der Amtsträger berührt werden. Dazu hat das BVerfG die Theorie der abgestuften Legitimationsdichte entwickelt.[63] Diese Theorie gilt für alle Fälle der Ausübung von Staatsgewalt, d.h. für jedes amtliche Handeln mit Entscheidungscharakter, obgleich sich dieses Handeln bereits unmittelbar nach außen auswirkt oder nur interne Voraussetzung für die Wahrnehmung der Amtsaufgaben ist.[64] Danach steigen die Anforderungen an die demokratische Legitimation je intensiver die Amtsaufgaben betroffen sind. Umgekehrt sinkt die Legitimationsdichte bei innerdienstlichen Maßnahmen, wenn gegenüber Dritten keine Aufgabenerfüllung stattfindet.[65] Dann sind auch Mitbestimmungsrechte möglich.
32
Für die Schulversammlung bedeutet dies: Sobald die Mitbestimmung über innerdienstliche Maßnahmen hinausgeht, muss die Letztentscheidungskompetenz dem vom Volk legitimierten Amtsträger vorbehalten bleiben.[66] In Fällen, die den Status der beteiligten Personen betreffen, ist eine hohe Legitimationsdichte erforderlich, so dass an die Unmittelbarkeit demokratischer Legitimation höhere Anforderungen gestellt werden. Zentrale Entscheidungen wie der staatliche Schul- und Erziehungsauftrag müssen weiterhin beim Staat bleiben. Fragen des schulischen Erziehungsauftrags betreffen immer auch Eltern und Schüler und damit Dritte. Eine rein innerdienstliche Maßnahme ist dann schon nicht mehr gegeben. Die Auswahl des Schulleiters geht über eine bloße innerdienstliche Maßnahme hinaus. Sie begründet das Amt, das maßgebliche Ausgestaltungsbefugnisse über den staatlichen Schul- und Erziehungsauftrag aus Art. 7 I GG verleiht. Sie bedarf daher einer hohen demokratischen Legitimation, welche die Schulversammlung nicht vermitteln kann. Zumal ist in keiner Weise ersichtlich, in welcher Form sie für ihre Entscheidungen verantwortlich gemacht werden könnte. Verantwortung darf gleichsam nicht in einem Gremium „verschwinden“.
b) § 18 (Ordnungsmaßnahmen)
33
Nach § 18 des Gesetzes kann die Schulversammlung über die Erteilung von Schulstrafen entscheiden und verhängte Schulstrafen aufheben. Auch insoweit stellt sich die Frage, ob das Legitimationsniveau der Schulversammlung für diese Befugnisse ausreichend ist. Eine bloße innerdienstliche Maßnahme, die den Amtsauftrag gegenüber den Bürgern nicht oder nur unmaßgeblich berührt,[67] würde eine Mitbestimmung zulassen. Die Verhängung von Schulstrafen im Sinne von Verweisen oder Disziplinarverfahren ist jedoch eine Entscheidung, die dem demokratisch legitimierten Amtsträger vorbehalten ist. Diese Sanktionen greifen in die Stellung bzw. den Status der Schüler ein, die sogar zur Beendigung des Schulverhältnisses (Verweisung von der Schule) führen können. Infolgedessen kann das Bestimmungsrecht des weiteren Bildungsweges und damit das Recht auf Ausbildungsfreiheit (Art. 12 I GG) beeinträchtigt sein.[68] Damit liegen Maßnahmen mit Außenwirkung und von erheblicher Bedeutung vor. Weiterhin sind zentrale Punkte des Schul- und Erziehungsauftrages betroffen. Maßnahmen wie Schulstrafen, die sich auf die „Mitgliedschaftsrechte“ eines Schülers auswirken, dürfen nicht an die Schulversammlung abgegeben werden, da hiervon schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betroffen ist.[69] In diesen Bereichen muss sich der Staat bzw. der demokratisch legitimierte Amtsträger eine Letztentscheidungskompetenz vorbehalten. Aufgrund von § 18 wäre dies nicht möglich, da die Schulversammlung mit der Mehrheit ihrer Stimmen selbst über diese Maßnahmen entscheiden und sogar Entscheidungen der Amtsträger aufheben würden.
Читать дальше