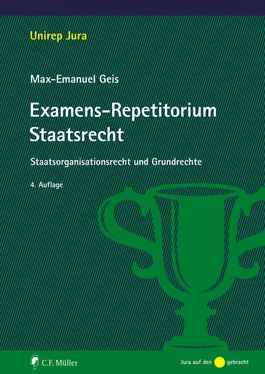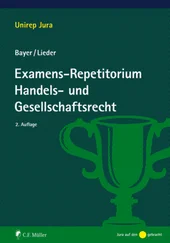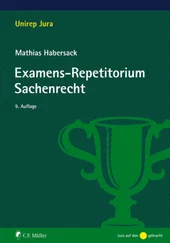4
(3)Als Verfahren zur Kreation von Normen stellt das Gesetzgebungsverfahreneinen Prototyp staatlichen Handelns dar; es birgt nicht nur viele Ansatzpunkte relevanter und irrelevanter Verfahrensfehler, sondern zeigt auch das föderativ geprägte Zusammenspiel von Bundestag und Bundesrat. Gerade deswegen scheint die Aufnahme eines Falles sinnvoll.
Im Folgenden wird versucht, den klausurrelevanten Stoff repräsentativ in examenstypischen Fällen zu erfassen: Die genannten drei „fallfreundlichen“ Staatsstrukturprinzipien sind mit je zwei Fällen vertreten, die Fragen um die Staatsorgane mit insgesamt vier Fällen (zwei „legislative“ und zwei „exekutive“ Beispiele). Dem Handeln der Legislative gilt schließlich der letzte Fall dieses Teils. Die möglichen Verfahrensformen des Verfassungsprozessrechts sind dabei in die einzelnen Fälle des Buches eingebettet. Sie werden durch Schemata begleitet, aus denen sich die Aufbaustruktur der jeweiligen Klage-/Antragsform einprägsam ergibt.
5
(4) Die weltweite Corona-Pandemie ab 2020 lässt auch das deutsche Staatsrecht unter einer neuen Perspektive erscheinen, da hier nahezu alle staatsorganisatorischen und grundrechtlichen Probleme gleichzeitig und flächendeckend auftreten. Die intensive Verknüpfung beider Bereiche soll in Fall 22 thematisiert werden.
§ 1 Staatsstrukturprinzipien
A. Demokratieprinzip
Fall 1 Der gewählte Schulleiter
Themenschwerpunkte:Demokratieprinzip, Staatsvolk, Legitimationskette, Formen demokratischer Legitimation, Legitimationsniveau, abstrakte Normenkontrolle
6
Das Bundesland X sieht eine Reform vor, nach der die Schulleiter an öffentlichen Schulen zukünftig von der Schulversammlung, bestehend aus Schülern, Lehrern und Eltern, gewählt werden sollen. Der Hintergrund hierfür war, dass viele Schulleiter zu autoritär auftraten und deshalb von den Schülern und der Elternschaft nicht gut angenommen wurden. Eltern, Schüler und Lehrer sollten selber bestimmen, wer denn ihr „Chef“ werden solle. Darüber hinaus solle die Schulversammlung auch bei Ordnungsmaßnahmen wie Verweisen, Disziplinarverfahren usw. mitbestimmen und -entscheiden dürfen. Das Landesschulgesetz wird – im ordnungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren – wie folgt ergänzt:
Der Schulleiter wird von der Schulversammlung mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder gewählt.
Die Schulversammlung kann mit der Mehrheit ihrer Stimmen über Verweise, Disziplinarverfahren usw. entscheiden und gegebenenfalls diese auch nachträglich aufheben.
Mit Hilfe dieser Reform will sich das Bundesland X als politischer Vorreiter in Sachen Demokratie und schulischem Mitbestimmungsrecht positionieren. Die Bundesregierung, die von anderen politischen Kräften dominiert wird, bezweifelt die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes und sieht gerade in der Reichweite der Kompetenzen der Schulversammlung einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Es könne nicht angehen, dass ein Gremium wie die Schulversammlung „einfach so“ wie der Staat handelt, ohne vorher vom Volk gewählt worden zu sein. Darüber hinaus sei es fraglich, ob eine Schulversammlung als echtes „Organ“ der Schule über die Geschicke der Schule und der Schüler entscheiden dürfe.
Trotz politischer Kontroversen hält die Landesregierung des Bundeslandes X am Regelungsvorhaben fest. Die Schulversammlung, die Eltern, Lehrer und Schüler als Betroffene gleichermaßen in die Entscheidungsprozesse einbeziehe, sei ein Musterfall gelebter Basisdemokratie. Im Übrigen gestatte das Demokratieprinzip, das verfassungsrechtlich für die Bundesrepublik als Ganzes gelte, durchaus Modifikationen auf der landesrechtlichen Ebene, solange die Homogenität gewahrt sei.
Die Bundesregierung will nicht nachgeben und beschließt im Kabinett, gegen diese Normen des Landesschulgesetzes beim BVerfG vorzugehen.
Bearbeitervermerk:
Hat das Vorgehen der Bundesregierung Aussicht auf Erfolg?
Lösung zu Fall 1
I. Verfahrensart
7
Als statthafte Verfahrensart kommt die abstrakte Normenkontrolle gem. Art. 93 I Nr. 2 GG; §§ 13 Nr. 6, 76 ff. BVerfGG in Betracht.
In diesem Verfahren obliegt dem BVerfG die Kontrolle bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetz oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages. Steht die Gültigkeit einer Norm in Frage, kann das BVerfG diese auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen und zwar unabhängig von ihrer konkreten Anwendung. Im Gegensatz zur konkreten Normenkontrolle nach Art. 100 GG muss die streitgegenständliche Norm nicht in einem konkreten Rechtsstreit maßgeblich sein.[1] Vorliegend bestehen Zweifel über die Vereinbarkeit des Gesetzes des Bundeslandes X mit dem Demokratieprinzip aus Art. 20 I GG. Die Bundesregierung will dieses Gesetz, ohne dass es bisher zu einer konkreten Anwendung gekommen wäre, auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen. Folglich ist die abstrakte Normenkontrolle die richtige Verfahrensart vor dem BVerfG.
Die abstrakte Normenkontrolle ist kein subjektives Rechtsschutzverfahren, sondern ein objektives Beanstandungsverfahren. Eine konkrete Rechtsverletzung ist daher nicht erforderlich und muss vom Antragsteller auch nicht geltend gemacht werden. Das Verfahren ist nicht kontradiktorisch, wird also nicht gegen einen Antragsgegner betrieben. Jedoch kann den in § 77 BVerfGG bestimmten Organen die Möglichkeit der Stellungnahme eingeräumt werden.[2]
8
Hinweis:
Entgegen dem ersten Anschein ist ein Bund-Länder-Streit gem. Art. 93 I Nr. 3 GG, §§ 13 Nr. 7, 68 ff. BVerfGG nicht einschlägig.[3] Hierfür mangelt es bereits an Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund und Land über ihre verfassungsrechtlichen Rechte und Pflichten. Dieses Verfahren ist bei einer Verletzung von Verfassungsrecht, das seine Grundlage nicht im Bundesstaatsverhältnis hat, nur einschlägig, wenn das Bund-Länder-Verhältnis durch diese Verletzung maßgeblich ausgestaltet wird.[4] Dieser Fall ist hier jedoch nicht gegeben.
Die abstrakte Normenkontrolle hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.
II. Zulässigkeit
1. Zuständigkeit des BVerfG
9
Die Zuständigkeit des BVerfG folgt aus Art. 93 I Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6, 76 ff. BVerfGG.
10
Die Antragsberechtigung ergibt sich aus der abschließenden Aufzählung des Art. 93 I Nr. 2 GG, § 76 I BVerfGG. Demzufolge sind nur die Bundesregierung, die Landesregierung und ein Viertel der Mitglieder des Bundestages antragsberechtigt. Stellt – wie hier geschehen – die Bundesregierung einen Antrag an das BVerfG, so muss diesem Antrag ein vorheriger Kabinettsbeschluss zugrunde liegen (§ 15 I lit. e) GO BReg); fehlt dieser, ist der Antrag unzulässig.[5] Vorliegend hat die Bundesregierung aber einen Kabinettsbeschluss gefasst. Daher sind die Voraussetzungen der Antragsberechtigung erfüllt.
11
Hinweis:
Vergleiche den Unterschied zum 1994 eingefügten Verfahren nach Art. 93 I Nr. 2a GG: Hier sind – weil es sich ausschließlich um die Wahrung von Länderrechten handelt – nur (!) der Bundesrat, die Landesregierungen und die Länderparlamente antragsberechtigt. Dieses Verfahren ist anwendbar, wenn Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, ob ein Gesetz speziell den Anforderungen des Art. 72 II GG entspricht.
12
Exkurs
Читать дальше