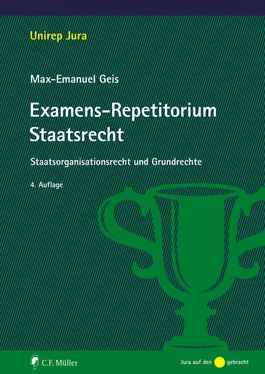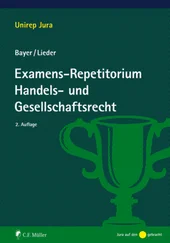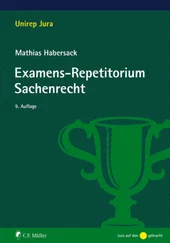Nr. 12: Prüfungsschema zur Kommunalverfassungsbeschwerde 971 Lösung zu Fall 2 Frage 1 I. Die Überhangmandatsregelung und Ausgleichsmandate[1] 37 Fraglich ist, ob die Überhang- und Ausgleichsmandatsregelung in § 6 IV 2 BWG und § 6 V, VI BWG seit der Wahlrechtsreform 2013 verfassungsgemäß ist. Dadurch könnte der Grundsatz der Gleichheit gem. Art. 38 I 1 GG und der Öffentlichkeit der Wahl gem. Art. 38 I 1 GG i.V.m. Art. 20 I, II GG sowie das Recht auf Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 I GG oder das Demokratieprinzip aus Art. 20 I, II GG verletzt sein. Folglich müsste eine Beeinträchtigung vorliegen, die durch das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland nicht gerechtfertigt ist.
Allgemein geläufige Abkürzungen sind nicht erfasst. Im Übrigen wird auf Kirchner, Abkürzungen der Rechtssprache, 8. Aufl. 2016, verwiesen.
| a.F. |
alte Fassung |
| BAG |
Bundesarbeitsgericht |
| BayImSchG |
Bayerisches Immissionsschutzgesetz |
| BayVerfGH |
Bayerischer Verfassungsgerichtshof |
| Bay. VGH n.F. |
Amtl. Entscheidungssammlung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs Neue Folge |
| BeckOK |
Beck’scher Onlinekommentar |
| BEEG |
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) |
| BK-GG |
Bonner Kommentar zum Grundgesetz |
| BT-Drucks. |
Bundestagsdrucksache |
| BWahlG |
Bundeswahlgesetz |
| DAR |
Deutsches Autorecht |
| EStG |
Einkommensteuergesetz |
| GewO |
Gewerbeordnung |
| GOBR |
Geschäftsordnung des Bundesrates |
| GOBT |
Geschäftsordnung des Bundestages |
| HdbVerfR |
Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (hrsg. von Benda/Vogel/Maihofer, 2. Aufl. 1994) |
| HessStGH |
Hessischer Staatsgerichtshof |
| HStR |
Handbuch des Staatsrechts (hrsg. von Isensee/Kirchhof, 3. Aufl. 2004 ff.) |
| i.E. |
im Ergebnis |
| i.R.d. |
im Rahmen des |
| i.S.d. |
im Sinne des |
| JuSchG |
Jugendschutzgesetz |
| MdB |
Mitglied des Bundestages |
| n.F. |
neue Fassung |
| NK-VwGO |
Nomos-Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung (hrsg. von Sodan/Ziekow), 8. Aufl. 2018 |
| NWVBl. |
Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter |
| OVG NW |
OVG für das Land Nordrhein-Westfalen |
| OWiG |
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten |
| PUAG |
Gesetz zur Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages (Untersuchungsausschussgesetz) |
| WRV |
Weimarer Reichsverfassung |
Zur Vertiefung empfohlene Literatur
Im Rahmen eines Examensrepetitoriums haben sich die Schrifttumshinweise auf die nötigsten Titel zu beschränken, da eine zu ausschweifende Literaturzusammenstellung der typischen Lernsituation vor dem Examen nicht gerecht wird. Ziel ist es nicht, den Stoff umfassend zu vermitteln und zu belegen – dafür stehen Gesamtdarstellungen und Kommentare in ausreichender Zahl bereit –, sondern das konzentrierte Wiederholen der wichtigsten und repräsentativen Klausurtypen. Die nachstehenden Werke bieten den Stoff jeweils bereits in konzentrierter Weise.
I. Staatsorganisationsrecht
Christoph Degenhart, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht, 37. Aufl. 2021
Christoph Gröpl, Staatsrecht I, 12. Aufl. 2020
Jörn Ipsen, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht, 32. Aufl. 2020
Stefan Korioth, Staatsrecht I, 5. Aufl. 2020
Hartmut Maurer, Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010
Volker Epping, Grundrechte, 9. Aufl. 2021
Friedhelm Hufen, Staatsrecht II. Grundrechte, 8. Aufl. 2020
Jörn Ipsen, Staatsrecht II. Grundrechte, 23. Aufl. 2020
Thorsten Kingreen/Ralf Poscher, Grundrechte. Staatsrecht II, 37. Aufl. 2021
Gerrit Manssen, Staatsrecht II. Grundrechte, 18. Aufl. 2021
Lothar Michael/Martin Morlok, Grundrechte, 7. Aufl. 2019
III. Verfassungsprozessrecht
Roland Fleury, Verfassungsprozessrecht, 10. Aufl. 2015
Christian Hillgruber/Christoph Goos, Verfassungsprozessrecht, 5. Aufl. 2020
Klaus Schlaich/Stefan Korioth, Das BVerfG, 12. Aufl. 2021
1. Teil Staatsorganisationsrecht
1
Im Bereich des Staatsorganisationsrechts lassen sich drei klausurrelevante Schwerpunkte kennzeichnen: (1)Geltung und Reichweite von Staatsstrukturprinzipien und Staatszielbestimmungen,[1] (2)Probleme um Status, Rechte und Pflichten von Staatsorganen sowie (3)– häufig als formelles Teilelement einer grundrechtlichen Fragestellung – Fragen des Gesetzgebungsverfahrens.
2
(1)Innerhalb der Staatsstrukturprinzipiennehmen das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und das Bundesstaatsprinzip einen herausragenden Platz ein. Im Rahmen des Demokratieprinzipsspielen wiederum Probleme der demokratischen Legitimationskette und des Wahlrechts einschließlich der Stellung von Parteien die dominierende Rolle. Zu den „klassischen“ Ausformungen des Rechtsstaatsprinzipsgehören die Problemkreise: Gewaltenteilung, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, Rechtssicherheit und Bestimmtheit, Vertrauensschutz und Rückwirkungsverbot sowie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, den man auch unmittelbar in der Grundrechtsdogmatik angesiedelt findet. Im Bundesstaatsprinzipfinden in Klausuren vor allem Fragen der Kompetenzordnung ihre Grundlage. Während die Gesetzgebungskompetenzen vergleichsweise geläufig sind (obwohl ihre Systematik nach der Föderalismusreform 2006 trotz des Wegfalls der Rahmengesetzgebung unübersichtlicher geworden ist), wird die weit kompliziertere Verwaltungskompetenzordnung meist sträflich vernachlässigt. Dagegen spielt das Sozialstaatsprinzip – eine Staatszielbestimmung mit unmittelbarer Geltung[2] –in schriftlichen Prüfungsarbeiten infolge seiner inhaltlichen Weite jedenfalls als eigenständiger Prüfungsgesichtspunkt eine eher untergeordnete Rolle und ist hier daher nicht mit einem eigenen Fall vertreten. Meist wird es als gesetzeskonkretisierender oder ermessensleitender Gesichtspunkt in Grundrechtsfällen angesiedelt sein; Leitbild ist hier nach wie vor die Numerus-Clausus-Entscheidung des BVerfG,[3] die die Ausbildungsfreiheit des Art. 12 GG mit dem sozialen Recht auf Chancengleichheit gekreuzt hat. Gleiches gilt für das Republikprinzip, das eher in verfassungshistorischen und staatstheoretischen Fragestellungen von Bedeutung ist, die dem mündlichen Examen vorbehalten bleiben.[4] Gänzlich außer Betracht bleiben hier das Umweltstaatsprinzipaufgrund seiner mangelhaften, weitgehend „falluntauglichen“ Konstruktion in Art. 20a GG sowie das Kulturstaatsprinzip, dessen Geltung als ungeschriebene Staatszielbestimmung zwar in Rechtsprechung und Schrifttum bejaht wird,[5] dessen normative Verankerung aber über einen geplanten, doch bislang unrealisiert gebliebenen Art. 20b GG nicht hinausgekommen ist.[6]
3
(2)Im Bereich der Staatsorganebieten die Rechte und Pflichten von Abgeordnetenund die Stellung von Ausschüssen(insb. Untersuchungsausschüssen) einen reichen Fundus für Fragestellungen. Unabdingbar für den Examenskanon ist die altehrwürdige Frage nach der Prüfungskompetenz des Bundespräsidenten, die durch „aktive“ Vertreter dieses Amtes ganz neue Aktualität gewonnen hat; hierdurch können wiederum andere – materielle – verfassungsrechtliche Fragestellungen „eingekleidet“ werden. Schließlich wirft die Frage nach dem originären Machtbereich der Exekutive das Problem deren Organisationsgewalt und damit der Gewaltenteilung auf; gleichzeitig baut sie mit den Stichworten „Wesentlichkeitstheorie“ und „Parlamentsvorbehalt“ die Brücke zu den Staatsstrukturprinzipien.
Читать дальше