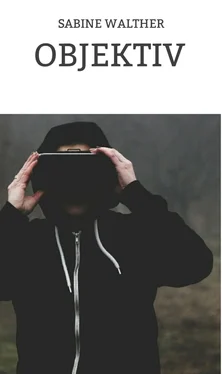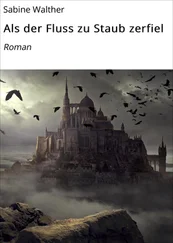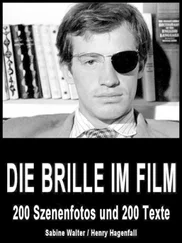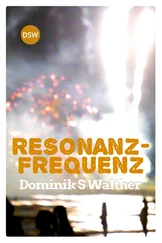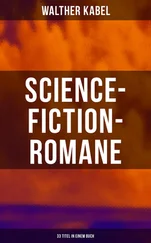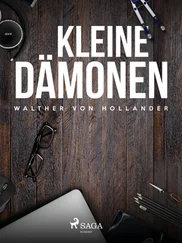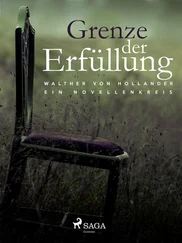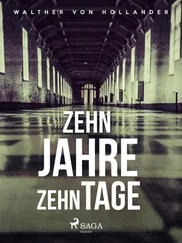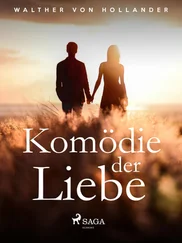„Ja,“ sagte er, „wo fange ich an. Beginnen wir mit den Empathie-Studien, die es schon gibt. An der Columbia University beispielsweise wurden dazu bereits diverse Versuche durchgeführt, aber alle mit demselben vernichtenden Ergebnis. Lässt man einen Menschen, der bereits über eine hohe Empathie-Fähigkeit verfügt, an dem Erleben eines anderen, der Gewalt, Leid oder Hass erfährt, teilhaben, so verstärkt das sein Mitgefühl. Versucht man dagegen, einen Gewalttäter oder Extremisten auf diese Weise zu therapieren, bleibt das gewünschte Ergebnis aus.
Kein einziger Gewalttäter oder Extremist wurde bisher dadurch geläutert, dass man ihn über einen Avatar nachempfinden ließ, wie sich seine Opfer fühlen. Ich habe mir die Ergebnisse sehr genau angesehen. Und ich denke auch, das Problem ist, wie Jan ja bereits anmerkte, dass die Probanden trotz des Eintauchens in die virtuelle Realität noch zu distanziert sind.
Sie werden von dem, was sie sehen, nicht wirklich berührt, es verändert sie nicht, es verstärkt nur, was schon vorhanden ist. Wer bereits über ein gewisses Mitgefühl verfügt, wird von dem, was er über so ein Empathie-Programm erlebt, berührt. Ist dies nicht der Fall, nutzt auch das Eintauchen in virtuelle Welten nichts.“
„Okay,“ sagte Marvin ungeduldig, „aber ich sehe derzeit keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern.“
„Ich denke, das Grundproblem ist“, fuhr Alexander unbeirrt fort, „dass die Probanden wissen, dass sie an einem Versuch teilnehmen. Und in der Regel dürfte die Initiative nicht von ihnen selbst ausgegangen sein. Das ist, als wolltest du jemanden hypnotisieren, der sich dem innerlich widersetzt. Es kann funktionieren, dürfte in den meisten Fällen aber nicht zielführend sein. Unsere erste Herausforderung besteht also darin, die Bereitschaft der Probanden zu stärken, sich auf das Experiment einzulassen. Sie müssen das Gefühl haben, dass die Aktivität von ihnen selbst ausgeht.“
Jan richtete sich auf, begeistert davon, wie rasch Alexander die wesentlichen Fragen begriff, die sich auch ihnen schon lange stellten. „Genau in diese Richtung haben wir auch schon gedacht“, sagte er anerkennend.
„Die Technologie an sich ist nicht das Problem, die ist weit genug fortgeschritten. Wir können sogar Blinden das Sehen wieder ermöglichen, indem wir per Laserstrahler die Vorgänge auf der Hornhaut simulieren. Blind sein bedeutet ja in den wenigsten Fällen, nichts zu sehen. Es bedeutet, aus dem, was man wahrnimmt, kein klares Bild formen zu können. Umgekehrt glauben wir oft genug, Dinge zu sehen, die so nicht existieren."
„Ist jetzt aber auch nichts wirklich Neues“, knurrte Marvin. „Haben die in Essen da nicht schon Studien zu laufen? Aber worin besteht der Zusammenhang zur Empathie?“, fragte er skeptisch nach.
„Das war ja erst einmal unser Ausgangspunkt. Was ich auf einem Bildschirm sehe, kann ich nicht fühlen oder begreifen. Es verstärkt, wie du sagtest, normalerweise nur irgendetwas, was ohnehin schon in mir ist.
Wie könnten wir also über eine VR-Brille die menschliche Wahrnehmung steuern und beispielsweise einen Gewalttäter zu einem besseren, im Sinne von mitfühlendem Wesen machen? Wie lehren wir Leute das Gute und Richtige sehen, die nur im übertragenen Sinne blind sind?“
„Gute Frage“, entgegnete Alexander, „es handelt sich um ein komplexes Zusammenspiel. Aber alles, was wir benötigen, ist längst vorhanden.Wir können den Sehvorgang simulieren, virtuelle Räume und Bilderwelten schaffen, Gedanken steuern. Es ist sogar möglich, durch elektronische Impulse Emotionen auszulösen. Wir müssen das alles eigentlich nur in einer Technologie zusammenbringen.
Das Entscheidende aber wird sein, dass der Proband wirklich das Gefühl hat, dass er selbst das Geschehen steuert. Die Aktivität muss von ihm selbst ausgehen. Und da wir ihn kaum dazu zwingen können, müssen wir ihm einerseits besondere Anreize setzen. So dass er einen Nutzen darin erkennt, Empathie zu entwickeln. Und wir müssen seine Eigenaktivität stärken. Das meine ich, wenn ich sage, wir setzen am Auge selbst an.
„Aber welche Anreize können wir schaffen? Die in Columbia haben ja auch schon einiges versucht. Wie bekommt man einen Nazi dazu, dass er von sich aus zustimmt, sich, wie soll ich sagen, läutern zu lassen? Wie bringt man einen Schwerkriminellen dazu, mit seinen Opfern zu fühlen?“
Alexander sah ihn an, sein Blick hatte sich verdüstert. „Tja“, sagte er, „durch Waffengewalt und Strafen jedenfalls nicht. Und auch Therapien helfen selten.“ Alexander nahm seinen ganzen Mut zusammen.
„Haltet mich bitte nicht für verrückt oder für einen spinnerten Romantiker“, sagte er, „aber es gibt nur einen Zugang zum seelischen Erleben des Menschen. Und der führt über das Auge, denn das Auge“, fuhr er mit leiser Stimme fort, „ist das Fenster der Seele.“
Entgeistert starrten die anderen ihn an, aber Alexander bemerkte es kaum noch, sprach und schaute, als würde er dem Gedankengang eines imaginären Gegenübers folgen.
„Natürlich“, sagte er dann, als würde er diesem zustimmen, „wir müssen nicht verändern, was sie sehen. Wir müssen beeinflussen, wie sie es tun.“
„Würden Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben lassen, Alexander?“, fragte Margarethe York leise, als wollte sie ihn nicht stören.
Alexanders Blick tauchte wieder in ihre Gegenwart ein und richtete sich auf die Anwesenden. „Habt ihr, haben Sie schon einmal etwas von Charles Russ gehört?“, fragte er. Sie verneinten.
„Sie können ruhig ‚ihr‘ sagen, wenn Sie uns gemeinsam ansprechen“, sagte Margarethe York.
„Okay, dann lasst es mich kurz erklären. Russ hat in den 1920er Jahren eine Apparatur entwickelt, mit der sich nachweisen ließ, dass das menschliche Auge in der Lage ist, Energie auf eine Drahtspule zu übertragen und diese in Bewegung zu versetzen oder zu stoppen. Ohne irgendeinen operativen Eingriff.
Basierend auf seinen Forschungen wurde eine Reihe dummer und unhaltbarer Thesen aufgestellt, die vor allem Esoteriker beschäftigten. Deshalb hat man die Experimente irgendwann wieder auf Eis gelegt.
Heute jedoch wissen wir: Ja, es gibt sie, diese Energie. Hinlänglich bekannt ist, dass zwischen vorderem und hinterem Augenbereich ein Spannungsunterschied besteht, den man sich in der Medizin bereits zunutze macht. Und auch für die Entwicklung der mindgesteuerten Drohne war dieses Wissen entscheidend. Warum sollten nicht auch wir Verfahren und Instrumente entwickeln, um damit arbeiten zu können?
Was mir vorschwebt, würde ich so beschreiben: Wir müssen es hinbekommen, dass die Aktivität des Probanden von seinem Auge selbst ausgeht. Erst dadurch verbindet sich der Betrachter ganz konkret mit dem Gesehenen.
Und erst auf diese Weise kann es sein Fenster zur Seele passieren. Er schaut nicht mehr passiv zu, sondern bringt sich aktiv ein und hat das Gefühl, das Geschehen zu steuern. Diese Erfahrung wird umso realer für ihn, je weniger er spürt, dass er überhaupt eine Technologie verwendet.
Während des Vorgangs wird sein Blick dann sozusagen von dem, was er sieht, geentert. Er kann sich dem Geschehen, das er selbst angestoßen hat, nicht entziehen.
Kurz und gut, wir müssen den Blick selbst digitalisieren, nicht die Bilder, die das Auge zu sehen bekommt. Über ein Brain-Machine-Interface behalten wir zudem die Kontrolle darüber, was er fühlt, denkt, in welcher mentalen oder psychischen Verfassung er sich befindet und können dies von außen bei Bedarf steuern.
Die Voraussetzung allerdings wäre, dass es uns gelingt, seine Augen zu elektrifizieren, sodass er“, er malte Anführungsstriche in die Luft, „die 'Spule' bewegen kann, ohne dass eine weitere Technologie zum Einsatz kommen muss. Denkbar wäre natürlich auch, dass man mit Kontaktlinsen arbeitet, aber das sind schon Detailfragen, da müsste man die Techniker hinzuziehen", kam er zum Schluss.
Читать дальше