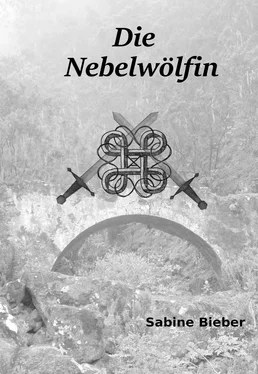„Ich hätte eine Taschenlampe mitnehmen sollen“, fluchte ich. Dann begann ich zu hysterisch kichern. Eine erwachsene Frau stapfte mitten im Winter im dunklen Wald umher, beladen mit einem riesigen Rucksack und suchte, ja nach was eigentlich?
Ich stolperte erneut und diesmal konnte ich mich nicht auf den Füßen halten und landete der Länge nach im nassen Laub. Gerade als ich mich aufrappeln wollte, gaben die Wolken den Blick auf den hellen, weißen Vollmond frei. Mir stockte der Atem, so unwirklich schön und gespenstisch zugleich waren der helle, weiße Mond, die dunklen Wolken, die vom Wind über den Himmel getrieben wurden und die schwarzen Baumwipfel, die sich als graue Schatten gegen den Nachthimmel abhoben. Das Amulett brannte jetzt fast schmerzhaft auf meiner Haut. Ich versuchte, den Schal beiseite zu schieben, um es zu berühren. In diesem Augenblick sah ich ihn und obwohl ich so darauf gehofft hatte, schrie ich leise auf. Ein weißer Wolf trat aus dem Nebel hervor und sah mich an. Seine Augen hatten die Farbe von flüssigem Gold. Kurz bevor ich irgendwas tun oder sagen konnte, legte das Tier den Kopf in den Nacken und stieß einen langen, klagenden Laut aus, der in meinen Ohren ein Echo verursachte. Ich schien einen Augenblick völlig körperlos zu sein. Mein Körper und mein Geist schienen sich voneinander zu trennen und ich wusste kaum noch, wo oder wer ich war. Die Welt um mich herum drehte sich und schien sich dann aufzulösen. Überall war irisierendes Licht und ich atmete den Geruch von schwarzer, feuchter Erde. Quälend langsam wurde mir schwarz vor Augen und ich sackte fast dankbar in die Dunkelheit, begleitet von dem Heulen des Wolfes, das zwischen den Welten widerhallte.
Irgendetwas war schief gegangen und ich war im offenen Meer gelandet. Es rauschte in meinen Ohren und selbst in der Trance, in der ich mich befand, merkte ich, dass meine Kleidung nass und schwer war. Da waren schmatzende Geräusche. Wahrscheinlich würde ich im nächsten Moment von einem riesigen Hai verspeist werden. Völlig bewegungsunfähig wartete ich auf den Todesstoß. „Seit wann schmatzen Haie?“, schoss es mir völlig zusammenhangslos durch den Kopf. Dann sprach jemand. Die Worte hörte ich, aber sie gaben irgendwie keinen Sinn. Ich versuchte den Kopf zu drehen, aber irgendwas nahm mir den Atem, ich schmeckte feuchte Erde und es knirschte zwischen meinen Zähnen. Ich fühlte, wie ich hochgezogen wurde und schlug mühsam die Augen auf, sie waren völlig verklebt.
Irgendwas stimmte nicht mit der Perspektive. Direkt vor meinen Augen tauchte immer wieder ein Kopf auf und von irgendwo her kam eine Stimme. Ich war nicht tot und einen Hai konnte ich in meinem begrenzten Gesichtsfeld auch nicht ausmachen.
„Hallo“, sagte die Stimme wieder und dann noch ein reichlich verdutztes: „Oh, dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen.“ Langsam klarte sich die Welt um mich herum wieder etwas auf. Da ich atmen konnte, war die Theorie mit dem Meer nicht länger haltbar und ich versuchte, mich aufzurichten und zu orientieren. Ich saß auf feuchtem Waldboden, gleich neben mir war eine sehr große, schlammig braune Pfütze. Meine Kleidung klebte mir feucht am Körper und so kam ich zu der Schlussfolgerung, dass ich bis eben in dieser Pfütze gelegen hatte, und zwar, so wie es aussah, mit dem Gesicht voran. Ich rieb mir mit den dreckigen Händen den Schlamm aus den Augen. Die schmatzenden Geräusche wurden von einem riesigen Pferd verursacht, das ganz in meiner Nähe an einen Baum angebunden war und etwas aufgeregt auf dem nassen Boden hin und her stampfte. Und dann tauchte wieder das Gesicht in meinem Blickfeld auf. Ich hätte es unter tausenden erkannt, auch wenn ich es bisher nur einmal kurz gesehen hatte. Der Mann, der mir am Strand aufgefallen war. Dornat.
„Ich habe es geschafft“, stieß ich knirschend hervor, dann wurde ich ohnmächtig.
„Geht es wieder?“, fragte er. Seine Stimme klang jetzt ehrlich besorgt. „Prima“, sagte ich und versuchte zu grinsen. Ich wollte mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich aussah. Ein Blick auf meine schlammverschmierte Kleidung ließ mich erahnen, wie ich im Gesicht aussehen musste. Aus meinen Haaren liefen kleine braune Rinnsale auf meine Jacke.
„Wie hast du mich denn gefunden?“, fragte ich und der Sand knirschte beim Sprechen zwischen meinen Zähnen. „Oh“, sagte er, und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. „Du warst eigentlich nicht zu übersehen. Es kommt nicht so häufig vor, dass Menschen mitten auf dem Weg bäuchlings im Schlamm liegen. Chiara hat dich zuerst entdeckt.“ Er wies mit der Hand auf die Stute, die immer noch am Baum angebunden war. Sie war gar nicht so riesig, wie ich zunächst geglaubt hatte. Nun wo ich aufrecht saß, sah sie aus, wie ein normales braunes Pferd.
„Kannst du mich zu Faolane bringen?“, fragte ich unsicher. „Klar“, sagte er und lächelte mich freundlich an. Normalerweise hätte ich mich wohl gewundert, dass er keine Fragen stellte. Er fragte nicht, wer ich war, wie ich hieß und wo ich herkam. Aber im Grunde wunderte mich im Moment gar nichts mehr. Ich hatte es nach Salandor geschafft und das war zunächst einmal alles, was zählte.
„Kannst du stehen?“, fragte er und reichte mir die Hand. Ich nickte stumm. „Bis zur Siedlung sind es wohl gute zehn Meilen. Meinst du, du kannst dich hinter mir auf dem Pferd halten?“ Er sah mich etwas zweifelnd an. „Ähm, ich denke schon“, sagte ich vorsichtig, „aber ist das nicht zu schwer, ich meine wegen des Rucksacks?“ Ich sah zweifelnd zwischen ihm und der Stute hin und her. Die Vorstellung, völlig schlammbeschmiert an einen irrsinnig attraktiven Mann geklammert auf einem Pferderücken herumzuhopsen, war mir nicht besonders sympathisch. Selbst gute fünfzehn Kilometer Fußweg schienen mir da noch die bessere Alternative. Er grinste schief und sagte dann betont lässig: „Ach, das schafft sie schon. Dann gibt es heute Abend eben etwas mehr Hafer.“ Er tätschelte der Stute den Hals und ich war mir zu hundert Prozent sicher, dass er merkte, wie unheimlich mir das Ganze war.
Er führte die Stute an einen Baumstumpf und schwang sich dann leichtfüßig in den Sattel. Danach bedeuteter er mir, dass ich auf den Baumstamm klettern und dann hinter ihm auf die Stute steigen sollte. Was im Film immer unheimlich leicht aussah, war in Wirklichkeit erniedrigend und albern. Ich hievte mich irgendwie hinter ihm auf das Pferd, das zum Glück wie eine Statue stand. Bevor ich zur anderen Seite wieder hinunter rutschen konnte, half er mir und schließlich schaffte ich es, irgendwie einigermaßen aufrecht hinter ihm zu sitzen. Schweiß lief mir über die Stirn. Ich versuchte mich nicht an ihm fest zu klammern, aber nach den ersten Schritten von Chiara gab ich auf. Ich konnte das Grinsen auf seinem Gesicht förmlich vor mir sehen, auch wenn er mir nun den Rücken zu wandte. „Ich bin Dornat“, stellte er sich nun endlich offiziell vor. „Du musst Lana sein, oder?“ „Woher weißt du denn meinen Namen?“, fragte ich und meine Stimme krächzte. Waren die Leute hier auch noch hellsichtig? Er hatte sich ja vorhin auch nicht darüber gewundert, dass ich zu Faolane wollte.
„Faolane hat dich angekündigt“, sagte er locker, als wäre es das Normalste der Welt, dass sie meine Ankunft voraus sah, bevor ich selber wusste, dass ich kommen würde.
Ich sagte nichts, sondern konzentrierte mich darauf, mich dem Rhythmus des Pferdes anzupassen. Wir ritten auf einem breiten Sandweg durch einen sommerlich grünen Wald, das Laub der Bäume war dicht und bildete ein grünes Dach über uns. Farn wucherte überall entlang des Weges. Der Weg verengte sich ein wenig und meine Beine streiften Hecken, an denen wilde Brombeeren wuchsen. Irgendwo plätscherte Wasser. Ich versuchte entspannter zu atmen und lockerte meinen Griff um Dornats Körper etwas. Der Wald wurde lichter, der Weg verlor sich auf einer großen Wiese voller Sommerblumen, auf der linken Seite glitzerte ein See in der warmen Sonne. „So muss das Paradies aussehen“, fuhr es mir durch den Kopf. Ich blinzelte in der Helligkeit. Leider war es mir nicht vergönnt den Ausblick noch länger zu genießen, denn Dornat sagte: „Festhalten, Lana“, und Chiara galoppierte an. Ich versuchte mich verzweifelt an meine Reitstunden zu erinnern, aber letztendlich blieb mir nichts anderes übrig, als mich wieder fest an ihn zu klammern. Ich fühlte seinen muskulösen Körper durch das dünne Leinenhemd und beschloss, an nichts anderes mehr zu denken, als daran, gleichmäßig weiter zu atmen und nicht vom Pferd zu fallen. Die Stute galoppierte trotz der Doppelbelastung gleichmäßig über die Wiese. Mir war unsagbar warm, es mussten mindestens zwanzig Grad sein und ich trug immer noch meine verdreckte Winterjacke. Später zügelte Dornat die Stute und ich löste meinen Griff ein wenig von seinem Körper. „Danke“, sagte er leicht zynisch, „nun bekomme ich auch wieder Luft.“ Ich wurde rot und war froh, dass er mich nicht sehen konnte.
Читать дальше