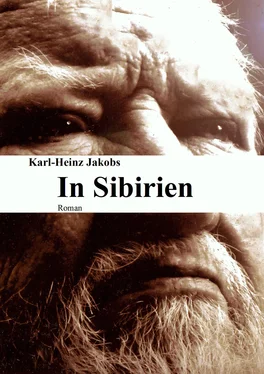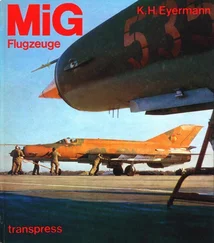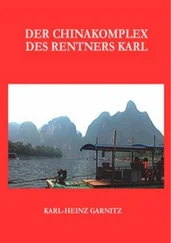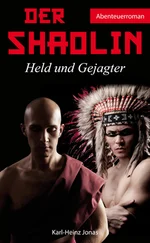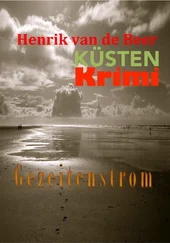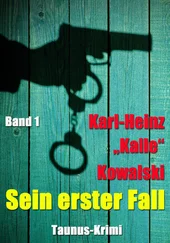„Ja“, sagte Satinajew, „so ist es.“
Lena wußte Bescheid. Jeder in der Sowjetunion wußte Bescheid, mochte er in Kirgisien leben oder am Tschirachtschai. Lena wußte Bescheid und erinnerte sich. Die Berichte in den letzten Jahren über Burgin in der Zeitung hatten sie erschüttert, ein Name, der wie Wawilows oder Lyssenkos 1936 in aller Munde war. Es ging, wie sie wußte, um den merkwürdigen Streit in der Biologie über die Vererbbarkeit anerzogener Eigenschaften, an dem die ganze Nation teilgenommen hatte, obwohl nur wenige etwas davon verstanden. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen, die mit politischen Verdächtigungen und persönlichen Beleidigungen geführt wurden, hatte es den ersten Toten gegeben, Akademiemitglied Burgin.
Wie alle im Volke, die nichts von Genetik verstanden, hatte sich Lena instinktiv auf der Seite derjenigen gestellt, die von der Vererbbarkeit anerzogener Eigenschaften träumten: Wenn es möglich war, den neuen, den sozialistischen Menschen zu schaffen, indem man ihm alle negativen Eigenschaften nahm, die ihm in Jahrtausenden von tierischen Zustandsformen bei der Menschwerdung anerzogen worden waren, müßte es auch möglich sein, Reis und Hirse so zu erziehen, daß sie in unwirtlichen Gebieten zu reichen Ernten führten, ein Nahrungsmittel-Überfluß ungeheuerlichen Ausmaßes wäre die Folge ... Lena glaubte fest daran.
Aber Leute wie Burgin hatten nicht nachgelassen, das Gegenteil zu beweisen: Hungersnöte würden ausbrechen, die Menschen würden beginnen, sich selbst aufzufressen. Scheußlich, dieser Kerl mit seinen inhumanen Prophezeitungen! Und als die Hungersnot tatsächlich ausbrach, als hätte er sie herbeigeredet, hatte jedermann im Volke gewußt, wer Schuld daran war. Volksfeind Burgin! Kopf ab! hieß es auf den Leserbriefseiten in den Zeitungen.
Es war die Zeit, als jedermann im Volke sich berufen fühlte, an Angelegenheiten des Staates und der Gesellschaft teilzunehmen und seine persönliche Meinung darzulegen, ein Triumph der Demokratie, wie Lena sie verstand. Aber Lena hatte auch Respekt vor dem Mann und seinem: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, amen! Sie spürte, daß Satinajew sie von der Seite betrachtete, spöttisch, wie sie mit kurzem Blick feststellte.
„Und was ist der Frau mit ihrem Gesicht passiert?“ fragte sie.
„Das Haus, in dem sie wohnte, brannte kurz nach der Hinrichtung ihres Mannes ab, sie konnte nur das nackte Leben retten, und nun glaube ich“, sagte Satinajew lächelnd, „habe ich Ihnen genug Stoff zum Nachdenken gegeben ....“
Vergessen war der Auftrag, im Lehrinstitut für Zivilingenieure nach dem Rechten zu sehen. Sie war schon wieder halb auf dem Pokrowskij Bulwar, sah schon die Lichter des Hauses der Rasturgujews, das sie wie einen Leuchtturm in stürmischer See begrüßte, als sie plötzlich stehenblieb. Aus den Tiefen des Pokrowskij Bulwars erscholl ein Chorgesang, der ihr in Mark und Bein schnitt. Es war Stalins Lieblingslied:
„Wetschernij swonn“, hallte es von weit und in getragenem Tonfall durch die beginnende Nacht, die ersten blassen Sterne waren schon zu sehen, danach aber kam nicht wie üblich das Bomm ..., Bomm ..., Bomm ..., sondern ein Geknatter aus Maschinengewehren: rattattattatta ..., rattattattatta ..., rattattattatta ... Erst, nachdem auch die Wiederholung des ersten Verses mit Geknatter verklungen war und nachdem Lena sich orientiert hatte über die Richtung, aus der die Salven kamen, fiel ihr ein, daß vielleicht die Insassen der Dscherschinskij-Kaserne zwischen Dreifaltigkeitskirche und Christi-Auferstehungs-Kathedrale etwas zu feiern hatten, den Jahrestag der Revolution vielleicht, dem zu Ehren sie übten? Auch die nächsten beiden Verse des von Stalin so sehr geliebten Liedes wurden von Geknatter aus Maschinengewehren begleitet: „Kak mnogo dum“, rattattattatta ..., rattattattatta ..., rattattattatta ...„na wadschit on“, rattattattatta ...., rattattattatta ..., rattattattatta ...
Es wurde eine sternklare Nacht. Auf dem Weg nach Hause, wie immer zu Fuß, sah sie hoch oben die fernen Lichter auf den Sperlingsbergen jenseits der Moskwa. Heute erheben sich dort in Marmor und weißem Sandstein, in einem Stil, der an asiatische Tempelbauten erinnert, nur höher, nur ausladender, nur massiger, die Türme und Kastelle der Lomonossow-Universität. 1936 gehörten die Lichter zu Irrenanstalt und Fußballstadion.
Flackernd spiegelten sich die erleuchteten Mauern des Kreml in den ruhig dahinziehenden dunklen Wassern des Flusses, der dieser Kapitale ihren Namen gegeben hat. Lena liebte diese Stadt über alles. Sie liebte diese Stadt, weil sie vor neun Jahren hier Asyl gefunden hatte, nachdem sie Hals über Kopf aus dem arbeitslosen Deutschland ins Vaterland der Werktätigen geflohen war. Den Ausdruck Vaterland der Werktätigen gebrauchte sie aus vollem dankbarem Herzen. Trotzdem fühlte sie sich in letzter Zeit so eingeengt, daß es ihr fast das Herz abschnürte.
Die Moskwa mündet in die Oka ... hatte sich Lena getröstet, die Oka rauscht in die Wolga, die Wolga fällt ins Kaspische Meer, dessen südliches Ufer bis nach Persien reicht, bis nach Persien! Mit zahlreichen Kanälen ist Moskau auch mit den Weltmeeren verbunden ... Nein-nein, dachte sie dann in manchmal aufsteigender Hoffnung, man war nicht abgeschnitten von aller Welt, wenn man in Moskau lebte, nein-nein, nein-nein, nein-nein.
Freunde
1936, dem Jahr, in dem meine Erzählung beginnt, lebte Lena nun schon neun Jahre in Moskau, war im Rang einer Genossin Oberleutnant Dozentin an der Militärakademie geworden, wo sie Deutsch unterrichtete. Den guten Ruf, den sie bei den angehenden Obersten und Generalen genoß, verdankte sie ihrer Findigkeit beim Ausknobeln neuer Methoden des Unterrichts. Großen Erfolg hatte sie, wenn sie versuchte, den ihr anvertrauten Offizieren Grammatik, Orthografie und Vokabeln mit Hilfe deutscher Volks- und Kunstlieder beizubringen. Sie hatte ein Buch zu dem Thema veröffentlicht mit dem Titel: ‘Wir singen und lernen deutsch dabei’. Ihr ganzes Repertoire an Liedern hatte sie mit nach Moskau gebracht, angefangen von Im schönsten Wiesengrunde bis zum Lied von der Erde von Mahler. Wenn sie mit ihrer klaren Stimme, die mal sanft, mal schneidend klang, die Melodien vorsang, saßen die hochrangig uniformierten Männer mit den Händen auf den Schenkeln da und lauschten gebannt. Allerdings war ihr anfangs übel geworden, als die zukünftigen Truppenführer: Reicht mir in der Todesstunde ..., ein Lied aus dem Repertoire der Berliner Arbeiterbühne, im Stil eines Donkosakenchors zu singen begannen. Das korrigierte sie umgehend mit wortreichen Standpauken ... Hier in Moskau hatte sie ihr Element gefunden.
Sie war nun vierzig ... Donnerwetter, wie die Jahre vergehen, man findet kaum Zeit, sich zu besinnen, ... hatte schlohweißes Haar, war klein und zart mit einem anmutigen Gesicht, aus dem die Reife einer geprüften Persönlichkeit sprach. Wenn sie sich in ihrer maßgeschneiderten Uniform auf der Straße zeigte, drehten sich manchmal Leute nach ihr um angesichts einer so reizenden, jugendlich wirkenden Person in Militärbluse, der das Haar weiß unter der Uniformmütze hervorquoll und sich breit über die Schultern ergoß. Sie war verheiratet, doch ohne Mann.
Das Unglaubliche war geschehen: Karcsi lebte mit einer anderen Frau zusammen, ausgerechnet mit der Siebenstern, die sich 1923 schon in Wien an ihn herangemacht hatte, als er und andere Überlebende der niedergeschlagenen Ungarischen Räterepublik in Baracke 23 des ehemaligen Grinzinger Seuchenhospitals Unterschlupf gefunden hatten. Damals hatte die Siebenstern ihr, Lena, weichen müssen. Doch nun hatte sie ihm in Moskau aufgelauert und galt als seine Sekretärin:
„Dieses häßliche Geschöpf mit spitzer Nase und breitem Kinn ...“ ereiferte sie sich, wenn sie sich bei Ervin beklagte.
Читать дальше