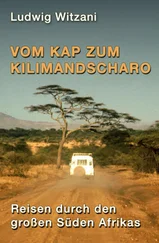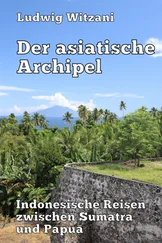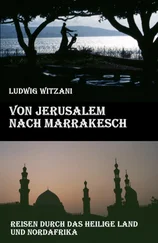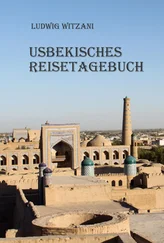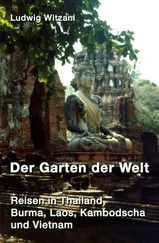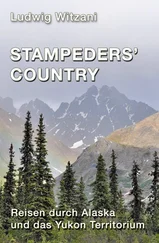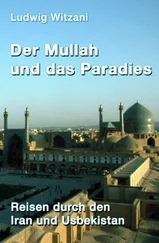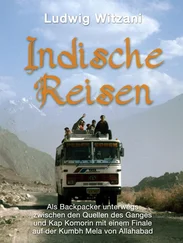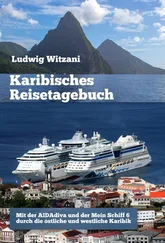1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 „Nyalam“ - „Hölle“ nannte der tibetische Yogi Milarepa das nepalesisch-tibetische Grenzland, in dem er im zwölften Jahrhundert unserer Zeitrechnung einige Jahre meditiert haben soll. Zerlumpte Kinder, denen der Rotz wie eine kleine Moränenlandschaft über Mund und Kinn lief, begannen zu betteln, kaum, dass wir die Fahrzeuge verlassen hatten. Ein Mönch, ein Soldat und ein
Nomade mit einer Ziegenherde standen plötzlich neben unseren Fahrzeugen, und in dieser Begleitung besuchten wir die Meditationshöhle des Milarepa, vor deren Eingang der 5. Dalai Lama im 17. Jahrhundert ein kleines Klostergebäude hatte erbauen lassen.
Das Klostergebäude war geschlossen, doch die Meditationshöhle des Milarepa stand für Besucher offen. Nur wenige Meter genügten, um die klirrende Kälte des Gesteins zu spüren. Mit jedem Schritt wurde es eisiger, weißer Hauch entstieg unseren Mündern, und der Widerschein der Butterkerzen erfüllte die uralte Höhle mit einer gespenstigen Lebendigkeit. Ich dachte an die Säulenheiligen der Spätantike, die unverdrossen in der glühenden Hitze auf ihren Emporen gestanden hatten - Milarepa, der als tantrischer Magier nach Belieben „tummo“, eine durch Yoga erzeugte innere Wärme hervorrufen konnte, repräsentierte offenbar das entgegengesetzte klimatische Kasteiungsprinzip: die Meditation und Versenkung im Permafrost. Kelsang, Kunga und Topchin verbeugten sich vor diversen Felsen und Steinen, auf denen nach der Überlieferung die Fuß- und Handabdrücke des Meisters zu sehen sein sollten. Für sie war der große Yogi keine geschichtlich abgelegte Gestalt, sondern eine gegenwärtige Wesenheit, ein großer buddhistischer Lehrer und Hochlandbarde, der in seinen „Hunderttausend Gesängen“ dem Volk die Feinheiten der buddhistischen Mahayana- Theologie in Gleichnissen und Geschichten verdeutlicht hatte. Milarepa, ein Zeitgenosse der mohammedanischen Sufis und jener christlichen Cluniazenser, die die abendländische Kreuzzugsbewegung ins Werk gesetzt hatten, war aber auch als Missionar erfolgreich gewesen. Vom Westen Tibets und dem heiligen Berg Kailash kommend, hatte Milarepa im frühen 12. Jahrhundert das tibetische Kernland erreicht, um es diesmal entgültig für den Buddhismus zu gewinnen.
Hinter Nyalam, das auf einer Höhe von knapp viertausend Metern lag, führte eine breite steinige Straße zum 5.055m hohen Lalung-Le Pass, auf dessen Scheitelpunkt man bei gutem Wetter dem Himalaja gewissermaßen in den Rücken hätte sehen können. Doch was man im Sommer von Dhulikhel in Nepal aus nicht erspähen kann, wird man auch von der anderen Seite nicht in den Blick bekommen. Wolken in allen Farbschattierungen von schwarzdunkel bis schäfchenhell, hier und da unterbrochen von tiefblauen Himmelsinseln, versperrten den Blick auf die Eisriesen des mittleren Himalaja. Sowohl der Gipfel des über siebentausendfünfhundert Meter hohen Chogsam wie auch die über achttausend Meter hohe Shisha Pagma-Kette verblieben hinter einer tiefschwarzen Wolkenfront. Umtost von eiskalten Winden glich der Lalung-Le Pass einem verwaisten Aussichtspunkt oberhalb der Welt, und die namenlosen Sechs- und Siebentausender, die ihn zur Gänze umgaben, erschienen in dieser Höhe nur als eine Ansammlung einsamer Hügel.
Hinter dem Lalung-Le Pass führte die Straße auf die Hochebene von Tingri, einem weitgezogenen Plateau auf einer Höhe von gut viertausenddreihundert Metern. Wir sahen die ersten Yakherden, eine Jurte, in deren Umgebung eine Herde Ziegen zum Melken zusammengebunden wurde, dann wieder lange Zeit nichts als Steintschörten und eine satt durchfeuchtete Landschaft, über der sich schwarzgraue Wolkendächer wölbten. Mitten hinein in diese Düsterkeit führte der Abzweig nach Rongbuk, einem etwa fünftausend Meter hoch gelegenen Kloster, hinter dem die Profis vom tibetischen Everest Base Camp aus die Besteigung des höchsten Berges der Welt in Angriff nahmen.
An derartige Heldentaten aber war für uns an diesem Tag nicht zu denken - im Gegenteil: der schnelle Anstieg über Zanghmu nach Nyalam und schließlich zum Lalung-Le Pass, der uns in nur einem einzigen Reisetag von 2.700 auf über 5.000 Höhenmetern geführt hatte, begann sich bemerkbar zu machen. Als wir am Abend das Qomolangma Hotel erreichten, plagten uns bereits starke Kopfschmerzen, die ersten und untrüglichen Symptome der Höhenkrankheit. Frank war ebenso bleich wie ich, und zum erstenmal waren wir froh, nicht anfassen zu müssen, als unser Gepäck in die kleinen Zimmer des Qomolangma Hotels verfrachtet wurde.
Von meiner letzten Erkrankung in Bolivien wusste ich, dass eine einmal ausgebrochene Höhenkrankheit zwar nicht mehr aufzuhalten, aber durchaus in ihrem Verlauf zu lindern war, vor allem, wenn man sich an die Erfahrungen der Einheimischen hielt. Auf dem bolivianischen Altiplano bedeutete das: cocahaltigen Mate-Tee trinken und darauf hoffen, dass die Symptome nach einem Tag verschwinden würden. Was in Bolivien mit dem Mate-Tee möglich war, funktionierte in Tibet mit dem Buttertee, einem salzhaltigen dickflüssigen Gebräu aus Yakbutter, das dem europäischen Gaumen etwa so schmeckt wie eine Tasse Lebertran mit drei Esslöffeln Salz. Während Frank und ich im Aufenthaltsraum des Qomolangma Hotels unschlüssig an der warmen, ranzig duftenden Flüssigkeit nippten, kippten Kelsang, Kunga und Topchin ebenso wie Tensing und Mun einen Becher Buttertee nach dem nächsten in sich hinein. Eigentlich war die Stimmung gut, draußen hatte ein Sturm begonnen, drinnen bollerte ein warmer Ofen unter jedem der großen Tische, so dass wir in behaglicher Wärme von Sven Hedins Abentern hätten erzählen können, wenn unser Befinden nicht stündlich schlechter geworden wäre.
Appetitlos und mit schmerzenden Knochen zogen Frank und ich uns schließlich in unsere Zimmer zurück. Doch an Schlafen war nicht zu denken - mehr noch: kaum lagen wir in unseren eiskalten Betten, steigerte sich die Pein zu ungeahnten Höhen. Das untergründige Kopfweh hatte einem stechenden, dolchartigen Schmerz platzgemacht, einem Gefühl, als sei der Kopf in ein Nadelkissen eingeklemmt, aus dem sich tausend winzige Messer in den Schädel bohrten. Keine Pein ist so schlimm, dass sie nicht noch schlimmer werden könnte, heißt es im “Bardo“, im buddhistischen Totenbuch, und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis zu den kaum noch erträglichen Kopfschmerzen ein erschreckendes Herzpumpen hinzukam. Und so sehr ich auch versuchte, durch alle möglichen Atemtechniken, Meditiationsübungen oder Körperhaltungen meine Qualen zu lindern - der einzige Effekt, der sich nach diesen Bemühungen einstellte, war eine unbeschreibliche Übelkeit, die mir zu meiner Überraschung noch quälender erschien als die Kopfschmerzen und das Herzpumpen.
Kurz nach Mitternacht sprang Frank wie von einer Tarantel gestochen auf und öffnete die Türe zum Hof. Augenblicklich erfüllte ein nasskalter Schwall kalter Luft das muffige Zimmer, ein Gewitter tobte über der Hochebene von Tingri, und der Himmel flackerte, als wäre das Ende aller Tage angebrochen. Zwei Hunde jaulten draußen zum Gotterbarmen, und für einen Augenblick fürchtete ich, sie würden uns in unserer Leidenskammer einen Besuch abstatten. Dann hörten wir die Geräusche eines Kampfes auf Leben und Tod, offenbar war ein dritter Hund im Hof erscheinen, der jetzt von den beiden Revierinhabern zerfleischt wurde. „Das ist die Hölle des Milarepa“, dachte ich immer wieder, während ich alle Geräusche der Außenwelt nur wie durch einen heißen Vorhang aus Schmerzen wahrnahm. Irgendwann schlief ich ein.
Als ich im Morgengrauen wieder erwachte, hatte sich mein Herzschlag normalisiert. Kopfschmerzen und Übelkeit waren einer latenten Benommenheit und Schwäche gewichen, doch im Vergleich zu den Unbilden der letzten Nacht waren diese Beeinträchtigungen locker zu ertragen.
Читать дальше