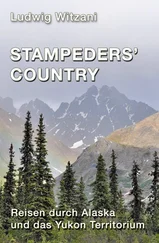Als wir Zanghmu erreichten, herrschte eine Atmosphäre wie in einem Gulag. Regen, Eis und Sturm hatten in Wechsel der Gezeiten den Asphalt von der Straße gerissen, und als wäre das nicht genug, riss ein fanatischer Maschinenführer gleich neben der Grenzstation am Steuerknüppel einer riesenhaften Bulldozermaschine ganze Felsen, Wurzeln und Bäume aus den Eingeweiden des Berges. Wieder goss es wie aus Kübeln, so dass wir eine halbe Stunde im Regen warten mussten, ehe die chinesischen Grenzbeamten sich dazu bequemten, aus ihrem Häuschen zu kommen.
Das Zanghmu Hotel war wie die Stadt, ein Haufen Müll in den Wolken. Die Kabel hingen aus den Wänden, die Teppiche waren feucht, die Matratzen so verwanzt, dass wir sofort unsere Schlafsäcke auspackten. Obwohl es regnete, als stünde das jüngste Gericht unmittelbar bevor, gab es im ganzen Hotel kein fließendes Wasser. In den Toiletten schissen die Gäste einfach auf die Würste ihrer unmittelbaren Vorgänger oder pinkelten in hohem Bogen aus dem Fenster hinaus. Ein unbeschreiblicher Gestank zog durch die Gänge, so dass wir nur das Gepäck deponierten, die Kleidung wechselten und so schnell wie möglich das Hotel verließen.
Aber offenbar ist kein Platz auf der Welt so schäbig, dass es nicht noch etwas zu handeln gäbe. Zu meiner Überraschung existierte in Zanghmu ein überdachter Markt, auf dem Chinesen, Nepali und Tibeter allerlei Elektronik, Textilien und Schmuck austauschten. Wie die Angehörigen unterschiedlicher Spezies wuselten die flinken Nepali und die geschäftstüchtigen Chinesen durcheinander, flankiert von tibetischen Lastenträgern, Tagelöhnern oder Nomaden. die in ihrer abgerissenen Landestracht scheinbar unbeteiligt neben dem Geschehen standen, als wären sie nur Gäste in ihrem eigenen Land. Sogar eine „Bank of China“ hatte in Zanghmu geöffnet - wenigstens theoretisch, denn als wir uns nach den Wechselkursen erkundigten, blieben wir völlig unbeachtet. Die beiden Chinesinnen hinter dem Tresen hatten weitab der Heimat anscheinend eine Menge zu bereden, und als wir es wagten, nach einer höflichen Wartezeit leise zu insistierten, gab es nur ein unfreundliches „Meo“ „Meo“, „Meo“, die Universalauskunft des chinesischen Amtsträgers, die in etwa so viel bedeutet wie „Haben wir nicht“, „Bekommen wir nicht“ und „Können wir auch nicht.“
Nachdem wir vergeblich versucht hatten, in der Bank of Zanghmu irgendein Zahlungsmittel zu wechseln, führten uns Tensing und Mun zum Ortsrand, wo wir Kelsang, Kunga und Topchin kennenlernten, unsere tibetischen Guides, die uns auf dem größten Teil unserer Reise durch Tibet begleiten würden. Alle drei waren bereits einen Tag vorher aus Lhasa kommend in Zanghmu eingetroffen, wo sie wohlweislich kein Hotel bezogen sondern im überdachten Laderaum ihres großen Dongfeng-Lastwagens geschlafen hatten.
Kelsang, eine temperamentvolle junge Tibeterin, begrüßte uns in fließendem Englisch mit einer Tasse heißen Tees, die sie auf einem kleinen Kocher neben den Fahrzeugen zubereitet hatte. Sie hatte ein offenes, sympathisches Gesicht mit den hohen Wangenknochen, die den tibetischen Menschen aus der Perspektive des Europäers ebenso fremdartig wie attraktiv erscheinen lassen. Offenbar kannte sie Tensing bereits, den sie ebenso wie Mun umarmte, und auch unsere geplante Route war ihr bekannt. Dreimal ließ sie sich unsere Namen buchstabieren, wiederholte und modulierte sie zur kindischen Freude aller Anwesenden, bis sie sie beherrschte und stellte uns dann die beiden Fahrer vor. Kunga, ein kleiner, etwas verwachsener Tibeter mit einer Stoppelfrisur und einer Knollennase, war der Fahrer des Jeeps. Er nickte zu allem und jedem, was auch nur irgendwer gerade sagte, verstand aber kein Wort Englisch und sollte während in den folgenden Wochen, egal ob im Schneeregen des Changthang oder im Sumpf der Tschochenpiste, immer nur im gleichen grünbraunen Anzug herumlaufen. Sein ganzes Sinnen und Trachten würde zuerst und vor allem seinem eierschalenfarbenen Jeep gelten, den er in jeder freien Minute reinigen und pflegen würde, bis er schließlich - kurz vor Ende der Reise, als der Wagen schließlich schrottreif gefahren worden war - mit ihm alleine in einem Nonnenkloster zurückbleiben sollte.
Von ganz anderem Kaliber war Topchin, der Fahrer des großen chinesischen Dongfeng-Lastwagens, auf dessen Ladefläche sich bereits unsere gesamte Expeditionsausrüstung befand. Topchin trug einen Hut wie ein Cowboy, er war großgewachsen, breitschultrig und kräftig, hatte ein sympathisches, intelligentes Gesicht und Hände wie Schaufeln, denen man auf den ersten Blick ihr handwerkliches Geschick keineswegs ansah. Topchin war die tibetische Hochlandvariante von Tensing, kräftiger, urwüchsiger und kantiger, aber von der gleichen Kompetenz und Zuverlässigkeit, die ihn mit seinem Dongfeng-Lastwagen schon durch ganz China geführt hatte. Wie wir später erfuhren, hatte Topchin am Beginn seiner Karriere auf fremde Rechnung über die Szechuan-Route Fernsehgeräte zwischen der chinesischen Stadt Chengdu in Szechuan und Lhasa in Tibet geschmuggelt, Grenzbeamte und Banditen in Amdo bestochen, sich mit den Wölfen im Hochland von Kham herumgeschlagen, ehe er mit seinem eigenen Fahrzeug und einigen Gehilfen über den sogenannten „Tibet-Highway“ kostbare Holzarbeiten vom Uigurenmarkt in Kashgar nach Shigatse brachte. Weil die Gewinnspannen im Tourismus zu seiner Überraschung die Profitmargen von Kühlschränken, Fernsehgeräten oder Holzarbeiten noch um ein Beträchtliches überschritten, arbeitete er nun im Tourismus. Schon bei unserer ersten Begrüßung ging etwas Starkes von ihm aus, ohne dass man auf Anhieb hätte sagen können, was es war. Er sprach nicht viel, doch wenn er etwas sagte, stockte das Gespräch und alle hörten zu. Frank und mich sollte er während der ganzen Reise nur ganz selten direkt ansprechen, vielleicht genierte er sich wegen seiner unzureichenden Englischkenntnisse, doch wusste er sich durch wenige, treffende Gesten verständlich zu machen.
Noch bevor es am nächsten Morgen hell wurde, verließen Frank, Tensing, Mun und ich das stinkende Zanghmu Hotel. Der große Lastwagen und der Jeep warteten schon in der Dunkelheit, die Sachen wurden verstaut, dann begann unsere Reise in die Wolken.
Bald lag das unwirtliche Zanghmu hinter uns, und schnell ging es in atemberaubenden Serpentinen in die Höhe. Es dauerte nicht lange, da waren die Bäume verschwunden, die Abhänge wurden kahler, ohne dass deswegen die Straßen rutschsicherer geworden wären. Aus den Tälern, die wir weit unter uns gelassen hatten, folgte uns der feuchte Nebel, der uns bald so vollständig einhüllte, dass sich die Sicht schon in einer Entfernung von wenigen Metern verlor. Ich dachte an die Transamericana im guatemaltekisch-mexikanischen Grenzgebiet, wo die Fernbusse die Wolken durchstießen und immer wieder in die Schluchten stürzten. Aber im Unterschied zu Guatemala waren die Straßen jenseits von Zanghmu weder geteert noch befestigt, und je gefährlicher die Pisten wurden, desto mehr erschwerten Regen, Nebel, Dunst und Unterspülungen die Orientierung. Auch wenn man die schwindelerregenden Abgründe jenseits der unbefestigten Straßenränder wegen des Nebels kaum sehen konnte – ihre gefährliche Nähe war so sicher wie die Präsenz der der chinesischen Kontrollposten an jedem kleinen Pass oder Ortseingang.
Erst in einer Höhe von weit über viertausend Höhenmetern riss endlich der Nebel auf. Der Grenzbereich des südasiatischen Monsuns war erreicht. Unter dunklen Wolkenwänden, gleißenden Himmelspassagen und eiskalten Schattenfronten durchfuhren wir eine unwirkliche Szenerie mit endlosen Geröllfeldern, spärlichem Ginsterbewuchs und wie abrasiert wirkenden Buckelbergen. Ein bitterkalter Wind peitschte über die kargen Ebenen, auf denen die Nomaden ihre Yak-Herden grasen ließen. Windschiefe Jurten standen am Rand der Weiden, wie rasend bellende Hirtenhunde rannten hinter unseren Fahrzeugen her.
Читать дальше