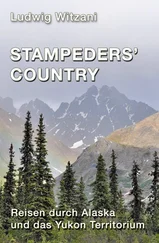Sein Partner, der Zeltsherpa Mun, sah aus wie ein junger Fuchs mit schrägstehenden Augen. Er wirkte auf mich zerbrechlich und unsicher, und als ich ihm die Hand gab, blickte er an mir vorbei, um sich gleich nach der Begrüßung ganz nach hinten zu setzen. Erst später erfuhr ich, dass unsere Tour Muns erste Reise als Sherpa war, und dass er schon das eine oder andere von der unberechenbaren Launenhaftigkeit der westlichen Kundschaft gehört hatte.
Keine Reise im Himalaja kann ein Erfolg werden, wenn du die falschen Sherpa dabei hast, heißt es irgendwo bei Sven Hedin. Aber woran erkennt man einen guten Sherpa? Von meinen früheren Wanderungen durch Nepal wusste ich nur, dass die guten Sherpas meistens nicht die waren, die viel redeten. Deswegen war es mir ganz recht, dass Tensing und Mun, kaum hatten sie ihre Plätze im Bus gefunden, sich einfach auf ihre Rücksäcke legten und einschliefen.
Inzwischen war die Morgensonne aufgegangen. Die Reisfelder und Wälder links und rechts der Straße schickten ihre nächtliche Feuchtigkeit als Nebelschwaden in den Himmel, so dass unser Fahrzeug wie durch eine endlose Reihe milchigweißer Vorhänge in den erwachenden Tag hineinfuhr. Erst in Dhulikhel wurde die Sicht etwas klarer. Nun hatten sich die Morgennebel zu weißen Wolkenschlangen zusammengeklumpt, die die umliegenden Bergabhänge wie Lametta verzierten. Für wenige Augenblicke hatte sich der Regenvorhang des Sommermonsuns vom Horizont zurückgezogen, um einen Blick auf eine fantastische Märchenwelt zu gestatten: Wie auf eine Familie von Riesen, bei denen der Fernere immer größer ist als der Nähere, mit weißen Fäden verziert, von denen man nicht sagen konnte, ob es Schneefelder oder Wolkenfetzen waren, so blickten wir für eine Sekunde in das feuchte Herz des Himalaja. Eine Unendlichkeit von Reisterassen wurden sichtbar, die einem System zerbrochener Spiegel glichen, die wie Brenngläser das Licht der Sonne reflektierten, wenn sie hier und da für wenige Augenblicke die Wolkendecke durchbrach. Dann schoben sich wieder die Wolken vor das Bild, und alles versank in einem stumpfen blaugrau.
Hinter Dhulikhel begann es wieder zu regnen. Die Straße war nun endgültig zu einer Piste geworden, unbefestigt und zunehmend rutschiger zog sie sich durch die Täler und passierte ein ärmliches Nepali-Dorf nach dem nächsten. Wasserbüffel standen teilnahmslos in einem Reisfeld, eine Mutter, die ihr Kind in einem Korb auf dem Rücken trug, hob die Hand und wollte mitgenommen werden, doch unser Fahrer winkte ab. „Diese Bauern bringen nur Dreck“, sagte er wegwerfend. „Außerdem klauen sie. Sollen sie doch den Bus nehmen.“ Tatsächlich kamen uns manchmal auch Busse entgegen, uralte Gefährte, die wie betrunkene Kolosse auf der glitschigen Straße an uns vorbeifuhren.
So vergingen die Stunden, ohne dass sich am Wetter oder an der Umgebung etwas Wesentliches änderte. Allerdings wurden die Reisefelder seltener, die Dörfer noch eine Spur erbärmlicher. Hinter Balabisa lagen noch die karrengroßen Felsbrocken in der Gegend herum, die beim letzten Steinschlag ins Tal herabgestürzt waren, doch die Straße war notdürftig freigeräumt. Der Fahrer küsste kurz die Ganesh Staue auf seinem Armaturenbrett, blickte die Bergabhänge hoch, an denen wegen des Nebels ohnehin nichts zu sehen war, und gab Gas. Wenn es jetzt krachte, war ohnehin nichts mehr zu machen.
Am frühen Nachmittag erreichten wir den Grenzort Kodari, ein langgezogenes Nest in einer Höhe von knapp 1800 Metern über dem Meeresspiegel. Von alters her nur eine Etappe auf den uralten Salzkarawanenrouten zwischen Tibet nach Nepal, hatte sich Kodari nach der Fertigstellung der Himalajastraße zu einem turbulenten Schnittpunkt der Welten entwickelt. Hier kreuzten sich die Wege von Gurkhas, Sherpas und Newaris, von Uiguren, Chinesen und Tibetern mit denen der wenigen Touristen, die überland nach Tibet reisen wollen. Eigentlich bestand der ganze Ort nur aus einer einzigen Straße, die tagaus tagein von Karren, Lastwagen, Bussen oder Gespannen verstopft war, so dass sich die Annäherung an die nepalesisch-tibetische Grenze etwa nach dem Prinzip einer Kniffel-Aufgabe vollzog: “Bringen Sie den roten Wagen möglichst schnell durch, ohne das die anderen es merken.“ Aber alle merkten es, alle drängelten, schnitten, rangierten und überholten so gut sie konnten, sodass das ineinander verkeilte Chaos immer unentwirrbarer wurde, je mehr wir uns der Grenze näherten.
Auf diese Weise dauerte es geschlagene zwei Stunden, ehe wir die nepalesisch-tibetische Grenze erreichten, eine unscheinbare graue Bogenbrücke, an deren Auffahrt nepalesische und chinesische Grenzbeamte die Reisedokumente kontrollierten. Je schlimmer der Anblick, desto freundlicher der Name, dachte ich, denn dieses Gebilde aus großen Schlaglöchern und fragmentarischen Brüstungen trug den stolzen Namen „Freundschaftsbrücke“.
„Einmal am Tag stürzt die Brücke ein“, spottete unser Fahrer, „hoffentlich nicht gerade dann, wenn wir auf der Brücke sind.“
Tatsächlich hatten wir Glück. Gerade als sich an der Abfertigung nur noch ein einziges Fahrzeug vor uns befand, stürzte urplötzlich und merkwürdig geräuschlos ein ganzes Brückenstück in die Tiefe. Der Zement hatte sich wie Fleisch von den Knochen gelöst, und während die Steine im reißenden Kodari-River unter uns verschwanden, war die Verbindung von Nepal und China auf ein zwei Meter langes Gestängegewirr reduziert.
Wirklich aufzuregen aber schien dieses Malheur jedoch Niemanden. Die Grenzbeamten zuckten nur mit den Schultern, da trat schon die ortsansässige Reparaturkolonne in Aktion. Eine Gruppe wüst aussehender chinesischer Straßenarbeiter erschien mit Zementsäcken, Hacken und Schubkarren und begann übergangslos zu rackern, als ginge es um ihr Leben. In gerademal einer guten Stunde hatten die sechs Wanderarbeiter aus Mörtel, Stangen, breiten Brettern und Schlamm das Loch in der Brücke so notdürftig wieder zugeschüttet, dass es wohl für den Rest des Tages keine Zwischenfälle mehr geben würde.
Die Nepalis beobachteten diese Arbeitsschlacht mit einer Mischung aus Staunen und Belustigung. “Diese Chinesen sind verrückt", sagte ein Lastwagenfahrer. "Sie arbeiten für ein paar Rupien wie die Sklaven.“
Hinter der Grenze befand sich ein großer Parkplatz, die Endstation für alle Fahrzeuge aus Nepal. Während Frank und ich, von Tensing und Mun unterstützt, unser gesamtes Gepäck auf die Ladefläche eines bereitstehenden chinesischen Dongfeng-Lastwagens umräumten, steckte sich unser Fahrer in aller Seelenruhe eine weitere Zigarette an. Ehe ich mich versah, war mein kleiner Rucksack mit meinem Fernglas und meinem MP3-Player verschwunden, Frank schlug einem Uiguren auf die Finger, der sich an seiner Jackentasche zu schaffen machte.
„Schön aufpassen“, rief uns der Fahrer zum Abschied. „Wenn ihr oben ankommt und euere großen Rucksäcke noch habt, könnt Ihr zufrieden sein.“ Mit lässiger Geste winkte er zum Abschied, ehe er wieder in seinen Wagen stieg und zurück nach Kathmandu fuhr.
„Alle Gepäcktücke festhalten“, rief Tensing auf Englisch, als er sich auf unsere Rucksäcke setzte. Wie in einem überfüllten Hühnerkäfig standen, lagen oder hockten einige Dutzend Menschen auf der offenen Ladefläche, als der Truck losfuhr, eine bunt durchmischte Gesellschaft voller Männer, Frauen und Kindern, Reisenden und Händlern, ehrlichen Leuten und Spitzbuben, von denen sich einer mein Fernglas und meinen MP3-Player unter den Nagel gerissen hatte.
Nur wenige Kilometer auf einer rutschigen Piste, aber fast eintausend Höhenmeter trennen die Grenzstation Kodari von Zanghmu, einer Retortenstadt, die die Chinesen wie einen schmutzigen Adlerhorst in einer Höhe von etwa 2.700m in die Abhänge der Berge hineingebaut erbaut hatten. Der Grenzkonvoi aus mehreren Fahrzeugen, der sich wie eine Karawane im Schneckentempo die glitschigen Straßen emporwand, benötigte für diese Strecke fast eine ganze Stunde. Das Kodari Tal mit der baufälligen Freundschaftsbrücke verschwand tief unter uns, und bald sahen wir nur noch die endlose Fahrzeugschlange vor der Grenze wie einen dünnen Faden, der sich im Nebel aufzulösen schien.
Читать дальше