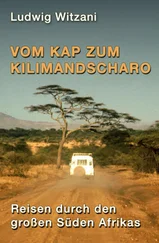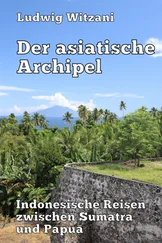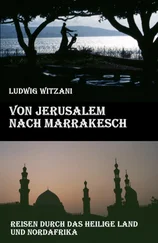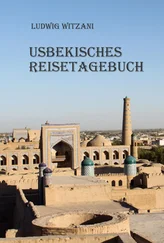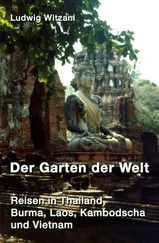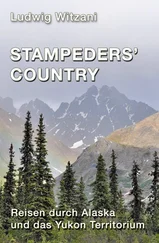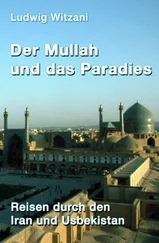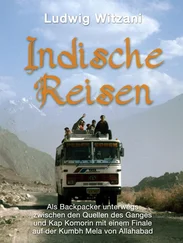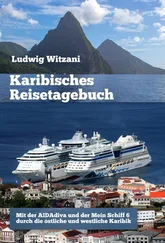Die Belesenheit und Bildung, aber auch die Strapazierfähigkeit der kleinen Frau grenzt von heute aus gesehen ans Unglaubliche. Wie von einem guten Geist geführt, erreichte sie fast mühelos all die heiligen Orte, nach denen sich Sven Hedin sein Leben lang vergeblich verzehrte, und doch veränderte sich, je mehr ich über sie und von ihr las, meine Einstellung ihr gegenüber ins Ambivalente. Die unbedingte Konsequenz all ihrer Handlungen wirkte auf mich übermenschlich, ihre innere Freiheit gegen alle Bindungen unbarmherzig, und ihr der altindischen Philosophie entlehntes Lebensmotto, das sie in bis in ihr hundertstes Lebensjahr durchhielt, erschien mir fast hybrid. „Sei Dir Dein eigenes Licht. Sei Dir deine eigene Zuflucht“, verkündete die berühmte Orientalistin bei jeder Gelegenheit, und auch wenn ich heute glaube, dass der Adel dieser Haltung der Besonderheit Tibets am ehesten gerecht zu werden vermag, erfüllte mich die autonome Eiseskälte, die hinter diesen Worten stand, damals mit Angst.
In den Neunzehnhundertachtzigerjahren begann ich endlich zu reisen. Aus Gründen, die hier nicht näher interessieren, besaß ich genug Zeit und Geld, um ausgedehnte Reisen durch Asien zu unternehmen - und ganz oben auf meiner Liste stand natürlich Tibet. Leider war unter den Bedingungen der chinesischen Okkupation Tibets lange Zeit an eine Tibetreise nicht zu denken. Aber eine Reise nach Nordindien und Nepal war möglich, und so flog ich mit Heinrich Harrers „Sieben Jahre in Tibet“ im Gepäck nach Indien.
Heinrich Harrer, meinem dritten und hochverehrten Tibet-Lehrer, bin ich in den unterschiedlichsten Altersstufen, in denen ich das Buch immer wieder aufs Neue las, stets mit der gleichen Begeisterung durch Tibet gefolgt. Am liebsten begleitete ich ihn auf seiner Reise durch die Schluchten des Himalaja zum Changthang oder zu seiner Audienz beim kleinen Dalai Lama, der mir anfänglich vorkam wie eine Mischung aus dem kleinen Prinzen, Mogli und dem noch kindlichen Jesus, der alle seine Lehrer mit seiner Weisheit überraschte. Harrer war es vor allem, der meine undeutlichen Ahnungen des Lhasa-Tales, des Potala und des Sommerpalastes mit Konturen versah. Vor meinen Augen entstanden Tempel und Paläste, Verschwörungen und Intrigen, ich empörte mich über die Anpasser und Verräter, die es auch auf tibetischer Seite gab, und konnte das Verhängnis gar nicht fassen, dass die Chinesen am Ende des Buches über das schutzlose Schneeland brachten.
Heinrich Harrer, der als Teilnehmer einer deutsch-österreichischen Nanga Parbat Expedition beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges von den Engländern gefangengenommen worden war, ehe ihm die Flucht nach Tibet gelang, war mir auch emotional näher als die fast übermenschliche Alexandra David Neél. Denn Harrer erscheint in seinem Buch niemals als autonomer Kompass seiner selbst, sondern als ein Verzweifelter, ein Getriebener und Gefangener, den die Sehnsucht nach der Heimat in die fantastischste Fremde trieb. Wenn ich also Heinrichs Harrers Spuren in Tibet noch nicht folgen konnte, dann wollte ich wenigstens seine Flucht aus dem Internierungslager beim nordindischen Dehra Dun bis zu den Quellen des Ganges nachvollziehen
„Bei Nacht marschieren, am Tage verstecken“, ist eines der Kapitel überschrieben, in dem Heinrich Harrer seine Flucht durch das Gangestal beschreibt. Ganz so strapaziös war meine Reise zu den Gangesquellen nicht, wenngleich der indische Bustransport von Delhi über Rishikesh und Uttarkashi nach Gangotri an Bedrängung und Bestürzung alles übertraf, was sich ein durchschnittlicher europäischer Busreisender überhaupt vorstellen konnte. Gähnende Abgründe, unbefestigte Straßenränder, Unterspülungen nach einem Wolkenbruch und haarsträubende Rangiermanöver entgegenkommender Fahrzeuge erforderten von den Bus-, Jeep- und Taxifahrern ein Ausmaß an Kaltblütigkeit und Mut, das jedem Extremsportler Ehre eingelegt hätte. Keinen halben Meter rollten die Reifen der bedrohlich schwankenden Busse an den unbefestigten Straßenrändern vorüber, während sich in der Ferne bereits das Quellgebiet des Ganges als grandiose Silhouette von Bhagirathi, Gangorti und Shivling andeutete. Wenn die indischen Busfenster nicht sehr klein und zudem auch noch vergittert gewesen wären, hätte man sich herauslehnen und geradewegs in die Abgründe blicken können, auf deren Grund der Lauf des Ganges wie ein silbernes Band aus Jade zu sehen war.
Gangotri, die Endstation aller Fernbuslinien in etwa dreitausend Höhenmetern, war ein unfrommes Nest mit lauter Wucherern, Halunken und falschen Gurus. Wer sich hier längere Zeit aufhielt, riskierte eine Gelbsucht, und so machte ich mich gleich am nächsten Morgen auf, um die letzte Etappe bis zur Quelle des Ganges zu Fuß weiterzuwandern. Der trügerisch leicht zu begehender Weg führte sachte bergauf, und nichts deutete darauf hin, dass Steinschläge, Wetterumschwünge oder die Tücken nicht trittfester Passagen jedes Jahr ihre Opfer forderten - nach Meinung der Gläubigen allerdings nur unter denjenigen, die die Wallfahrt ohne Demut begingen. An diesem Tag schien es gottlob unter den Pilgern keine Spitzbuben zu geben. Stabil, wie für die Ewigkeit an die Berge geklebt, lagen die Felsen auf den Abhängen, ein sachter Wind wehte durch das sachte ansteigende Tal, und nichts war zu hören als das Rauschen des jungen Götterflusses. Gravitätisch einherschreitende Swamis, uralte Frauen, die Rücken wie Halbmonde gebogen und auf Stöcke gestützt, die dicker als ihre Handgelenke waren, Sadhus, Bettler und Familien mit Kindern defilierten über den Pilgerpfad, begegneten mir oder überholten mich, ehe ich mich an einem Aussichtspunkt zur Rast niederließ. Ich wollte gerade weitergehen, als sich unmittelbar neben mit zwei Pilger niederließen, die mir schon gestern im Bus aufgefallen waren, ein tibetischer Mönch in rostroter Kutte und ein Europäer in der indischen Sanyasin-Tracht, die darauf bestanden, ihr Dal mit mir zu teilen. Shen, der junge tibetische Mönch, stammte aus dem indischen Dharamsala, der Residenz des Dalai Lama und dem Sitz der tibetischen Exilregierung. Er war vor sechs Wochen zu einer Pilgerfahrt zu den Gangesquellen aufgebrochen, denn auch die tibetischen Buddhisten verehren den Ganges als einen heiligen Fluss, weil seine Quellgewässer unterhalb des Bhagirathi über einen unterirdischen Wasserlauf mit dem Manasarovar-See in Westtibet verbunden sein sollen. Shens Vorfahren kamen aus Tsethang, der drittgrößten Stadt Tibets, doch er selbst war bereits im Exil geboren worden, ohne dass er bisher Gelegenheit gehabt hatte, seine Heimat zu besuchen. Erst seit einer Woche reiste er zusammen mit dem Polen Karol, einem kurzgeschorenen hageren jungen Mann mit einem gütigen Gesicht, der alle seine Zelte in der Heimat abgebrochen hatte um nun schon seit zwei Jahren in den unterschiedlichsten Ashrams Indiens die Bhagavadgita zu studieren. Auch ich erzählte von meiner Herkunft, meinem Leben, meiner Passion für Tibet, worauf mir Shen spontan und unter zustimmendem Kopfnicken von Karol erklärte, meine Sehnsucht nach Tibet sei der Überrest eines früheren Leben. „Jede Sehnsucht ist ein innerer Reflex auf Erlebnisse in vergangenen Leben“, ergänzte Karol. „Die Seele erinnert sich umso besser, je glückhafter ihre Reinkarnation in einem früheren Leben gewesen sei.“ Als skeptischer Spross der 68er-Kultur kam mir eine solche These natürlich vollkommen abartig vor, aber in der magischen Umgebung des Gangestales erschien mir plötzlich alles möglich, und so ließ ich es auf sich beruhen
Zu dritt legten wir den letzten Teil der Reise zu den Gangesquellen zurück. Inzwischen war alle Vegetation verschwunden, Geröllfelder und Moränengletscher bestimmten das Bild, als wir am späten Nachmittag das Bhagirathi-Massiv in knapp viertausend Höhenmetern erreichten. Hinter einer letzten Felsenkurve wurde schließlich das „Kuhmaul“ sichtbar, eine fünf- bis sechs Meter hohe halbkreisartige Gletscheröffnung, aus der das Gangeswasser, wie von Turbinen angetrieben, tosend herausschoss. Ein einziger Blick genügte jedoch um zu erkennen, dass die Quelle des Ganges nicht nur ein heiliger, sondern auch ein gefährlicher Ort war. Rasant überhängende Gletscherbalkone überwölbten die Quelle, und keiner der Pilger wagte sich näher als zwanzig oder dreißig Meter an das Kuhmaul heran.
Читать дальше