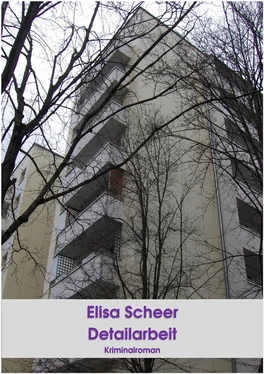Auf dem Weg in die Lessingstraße kam der Schnee natürlich die ganze Zeit von vorne und setzte sich in meinen Haaren und in den Wimpern fest. Manchmal schnaufte ich leidvoll durch den Mund und schnappte dabei ein paar Schneeflocken auf, die kalt und geschmacklos auf meiner Zunge zergingen; wahrscheinlich nahm ich dabei mehr Dreck als Schmelzwasser auf.
Schließlich taumelte ich halb blind in unsere Hofeinfahrt, wieder einmal froh darüber, dass wenigstens die ewig knarrende Haustür wettergeschützt war, wühlte in meiner Hosentasche nach dem Hausschlüssel und lief die Treppen hinauf in den zweiten Stock. Ein Lift wäre schön, dachte ich nicht zum ersten Mal, aber das war eben nicht der Typ Haus, in dem es einen Aufzug gab.
Ich hatte mal in einem Stadtteilbuch nachgelesen, dass die Lessingstraße 1909 mit uniformen Wohnblöcken bebaut worden war – etwas sparsame Neurenaissancefassaden, zwei Hinterhäuser, vier Etagen, relativ kleine Wohnungen mit maximal drei Zimmern. Vorstadthäuser eben. Eines der Häuser, Nummer 18, hatte im Krieg einen isolierten Treffer abbekommen (eigenartig, in Bahnhofsnähe nichts Schlimmeres?) und war durch einen Fünfziger-Jahre-Bau ersetzt worden, bei dem die Geschosshöhen nicht stimmten und statt Stuck eine pseudoabstrakte Bemalung in Rostrot und Senfgelb angebracht worden war. In den Siebzigern hatte man alle Häuser so weit renoviert, dass sie brauchbare Bäder und statt der Kohleöfen Zentralheizung bekommen hatten – aber keine Aufzüge.
Jedes Haus enthielt zwei Läden, einen Laden und eine Kneipe oder zwei Kneipen. In unserem Erdgeschoss befanden sich ein kürzlich eingegangener Laden für Haustierbedarf – jedenfalls klebte das Maklerschild immer noch an dem fast blinden Schaufenster – und die Lessingquelle, wohl die schauerlichste Kneipe weit und breit. Hier trauten sich nur hartgesottene Trinker hinein, das aber gerne auch schon vormittags. Frauen wurden dort fast nie gesehen, und wenn, standen sie kurz vor der Pennerexistenz oder sahen wenigstens so aus. Angst machten mir die Kerle nicht, die meisten waren, wenn sie einem Unanständigkeiten nachriefen, so wacklig auf den Beinen, dass man sie wahrscheinlich mit einem Finger umwerfen konnte. Sogar die regelmäßigen nächtlichen Prügeleien auf dem Bürgersteig verliefen meistens im Sande, weil die Kämpfer nach dem ersten Sturz nicht mehr hochkamen oder erst einmal kotzen mussten. Solange ich morgens guckte, wo ich hintrat, konnte ich damit leben – und die Miete war relativ billig.
Der Vermieter versuchte zwar, seitdem ich dort wohnte, die Lessingquelle loszuwerden, aber es gelang ihm nicht. Immer wenn das Ordnungsamt kam, benahmen sich die Saufköpfe ganz gesittet und in der Küche blinkte es nur so. Dann guckten die Beamten den armen Schwaiger an, als hielten sie ihn für einen Querulanten, und erzählten ihm Geschichten von anderen Lokalen, mit Ratten in der Küche, Leichen auf dem Klo, brennendem Fritierfett und Drogenhandel vor der Tür. Ich hatte Schwaiger schon mal vorgeschlagen, Ratten zu züchten und sie dort loszulassen, aber er hatte zu Recht argumentiert, dass wir die Viecher dann in Nullkommanichts überall hätten.
Also hatte Schwaiger allmählich resigniert und war froh, wenn er zwei ziemlich ordentliche Zimmer in zentraler Lage (Bahnhofsnähe!) für durchschnittlich vierhundert Euro warm loswurde. Ich zahlte sogar nur dreihundertdreißig, weil ich keinen Keller hatte – in dem lagerte die Lessingquelle nämlich ihren Schnaps - und mein Grundriss so bescheuert war.
Im Winter war das egal, wer wollte da schon auf den Balkon, aber im Sommer fand ich es schon blöd, dass der Balkon vom Schlafzimmer abging. Die großen Siebziger-Jahre-Heizungen nahmen Stellfläche weg, und der Mosaikparkettboden hätte Abziehen und Neuversiegeln gebraucht, aber sonst konnte ich zufrieden sein.
Naja - ich hängte den feuchten Mantel auf und sah mich um. Grauenvoll! Mit Fußtritten schob ich die überall herumliegende Wäsche wenigstens ins Schlafzimmer und machte flüchtig das Bett. Genau genommen zog ich bloß die unaufgeschüttelte Decke über das verknüllte Laken, dann reichte es mir schon wieder.
Erstmal einen Tee! Aufräumen konnte ich am ersten Feiertag, da hatte ich ja sonst nichts zu tun. Ich setzte Wasser auf und wählte nach längerem Überlegen aus meiner großen Auswahl an angebrochenen Teeschachteln einen Beutel Limette aus. Früchte- und Aromatees konnte ich nie widerstehen, von jedem Einkauf brachte ich eine neue Sorte mit. Manche waren eher seltsam, manche schmeckten bloß künstlich, aber die meisten waren wirklich lecker. Und Limette gehörte auf jeden Fall dazu. Während das Wasser zu sieden begann, sah ich auf die Uhr. Verdammt, zehn vor acht, ich würde saftig zu spät kommen!
Für eine Dusche reichte es nicht mehr. Ich goss hastig den Tee auf, schaltete den Herd aus und rannte ins Bad, um mein Make-up zu erneuern und mir wenigstens die Haare zu bürsten und sie frisch zusammen zu binden. Zu viele Haare, dachte ich manchmal. Sie waren so dick und auch ein bisschen lockig, dass ich mit der Bürste abends kaum durchkam; und wenn ich sie nicht zusammenband, standen sie wie eine Wolke um meinen Kopf. Bloß eine aschblonde Wolke zwar, aber trotzdem sah das dann doch eher seltsam aus.
Wahrscheinlich würde Conny mich wieder mit Stylingtipps nerven – aber ich war mit dem plustrigen Pferdeschwanz eigentlich ganz zufrieden. Und für wen sollte ich mich schon so aufbrezeln? Für die Verbotene Stadt etwa? Da guckte doch eh kein Schwein!
Die grauen Jeans und das grauweiß gestreifte Sweatshirt mit der rosa Brusttasche genügten auch vollkommen, schließlich konnten Conny und Hardy sich doch denken, dass ich praktisch direkt von der Arbeit kam, wenn wir uns um acht trafen. Acht? Eher Viertel nach, es war schon fünf vor. Jetzt aber schnell!
Ich kippte den Tee herunter, steckte Geld und Schlüssel ein, schnappte mir meine Daunenjacke und machte, dass ich wegkam. Bloß gut, dass die Verbotene Stadt gleich in der Gellertstraße war, nur zwei Ecken weiter.
Als ich meinen Eltern damals erzählt hatte, wo ich eine Wohnung gefunden hatte, waren sie begeistert: lauter deutsche Dichter in diesem Viertel – und fast alle aus dem achtzehnten Jahrhundert, da schlugen ihre Germanistenherzen höher. Dass die Gegend ein bisschen schäbig war, fanden sie nicht so tragisch, sie hatten sich nie so ganz von ihren Studentenidealen verabschiedet. Das machte einen Teil ihres Charmes aus, fand ich, während ich durch das lästige Schneetreiben hastete und schließlich die Tür der Verbotenen Stadt aufstieß: Warme Luft, Geruch nach süßsaurer Sauce und Jasmintee, diskretes Geschirrgeklapper.
Jasmintee war überhaupt die Idee!
Ich sah mich suchend um und entdeckte Conny und Hardy in einer rot tapezierten Nische. Goldene Drachen züngelten auf sie hernieder. War der Drache in der chinesischen Vorstellung nicht ein freundliches Tier? Die da sahen eigentlich nicht so aus. Hardy sah mich zuerst und winkte mir zu; Conny blickte erst von ihrer Speisekarte auf, als ich mich auf die rotlederne Bank ihr gegenüber schob. „Fix und fertig?“, erkundigte sie sich freundlich. Ich knurrte. „Speisekarte her! Ich bin richtig ausgehungert. Zehn Stunden Terror!“
„Weihnachten ist immer Terror“, fand Hardy und musterte mich mitleidig durch seine runden Brillengläser. „Konsumterror, ich weiß“, antwortete ich und schlug die Karte auf, die Hardy mir gereicht hatte. „Aber wir leben davon, dass die Leute sich wenigstens ein paar Schmöker unter den Baum legen. Außerdem kann man nie genug Bücher haben.“
Dem konnte Hardy als examinierter Germanist schlecht widersprechen, aber er versuchte es trotzdem: „Aber solcher Schrott wie das Zeug von Dieter Bohlen ist ja wohl nichts, was man Weihnachten verschenken sollte!“
„Solchen Mist führen wir gar nicht“, verwahrte ich mich entrüstet gegen diese Unterstellung. „Und was schenkst du deiner Familie?“, lenkte Conny uns von unserem Dauerstreit über die allerunterste Niveaugrenze für Literatur ab und klappte die Karte zu. „Ich nehme die süßsaure Ente.“
Читать дальше