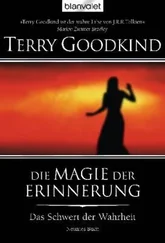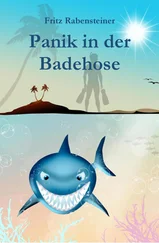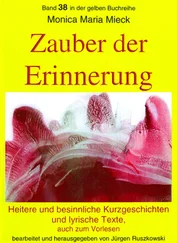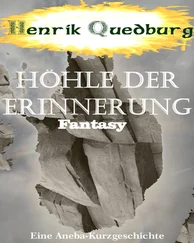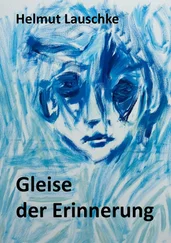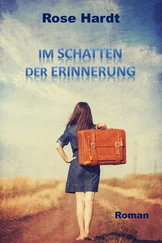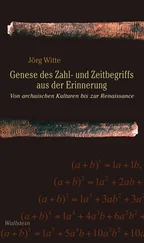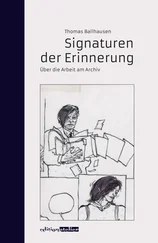Fritz Mierau - Keller der Erinnerung
Здесь есть возможность читать онлайн «Fritz Mierau - Keller der Erinnerung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keller der Erinnerung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keller der Erinnerung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keller der Erinnerung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keller der Erinnerung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keller der Erinnerung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Häuslichkeit war in Mandelstams Sinn Welthäuslichkeit, Zuhausesein in der Welt und ganz modern sprach er sogar von der „Ökonomie mit ihrem Pathos der Welthäuslichkeit“, vom „Welt-Herd“. Mandelstam nannte das seinen „häuslichen Hellenismus“. Hellenismus in Mandelstams Verstand ist der Herd, an dem der Mensch sich der Wärme freut, die seiner inneren Wärme verwandt ist, es ist der Topf auf dem Herd und der Krug Milch, es ist die Verwandlung der Gegenstände in Gerät und Geschirr, die Erwärmung der Welt durch die feinste teleologische Wärme – den menschlichen Geist. Es ist dieser häusliche Hellenismus, der Mandelstam die Pflanzlichkeit der gotischen Architektur in seinen „Stein“-Gedichten entdeckt, die Bienen, Hummeln und Wespen, die Grillen und Libellen, Honig, Milch und Wein, Heu und Stroh und Schaf und Schwalbe in den „Tristia“-Gedichten beschert und zum Schluß die Schwarzerde, die Erde seines Woronesher Verbannungslandes, die wie die Sprache ist, in die er zurückkehrt.
Diese „Erwärmung der Welt“ erwärmte auch alle Überlieferung. Statt einem „Leben von kultureller Rente“ lebte Mandelstam ein Leben im steten Gespräch mit Dante, Bach und Goethe, mit der „Göttlichen Komödie“, mit der „Matthäus-Passion“, mit „Wilhelm Meister“, knackte Nüsse in Walhalla und ergötzte sich an der „Kolumbusbuntheit“ Linnéscher Naturbeschreibung, in der „Adam Belobigungsurkunden“ verteilt und „sich einen Zauberer aus Bagdad und einen Mönch aus China zu Gehilfen gebeten“ hat.
Welche Freiheit.
Welcher Anspruch.
Welcher Vorsatz.
1937, in der Woronesher Verbannung hat Mandelstam seine Welt-Häuslichkeit gegen die „Wassersucht der Weltthemen“ abgegrenzt:
Wenn ein Schriftsteller es für seine Pflicht hält, koste es was es wolle, „das Leben tragisch zu sagen“, aber auf seiner Palette keine tiefen kontrastierenden Farben besitzt, und vor allem das Gefühl für das Gesetz nicht hat, nach dem das Tragische, auf welch kleinem Abschnitt es immer entstehe, sich unweigerlich in ein allgemeines Bild der Welt fügt – bringt er nur „Halbfabrikate“ von Schrecken und Borniertheit hervor, Rohmaterial, das Ekel erregt und bei der wohlmeinenden Kritik den zärtlichen Namen „Milieu“ trägt.
Das geschichtlich Ungeheuerliche und nicht Geheure des blutigen Umsturzes und Umbaus in Rußland hat in Ossip Mandelstam einen in Furcht und Schrecken zum Opfer bereiten Dichter gefunden, der sich nicht mit „Milieu“-Szenen begnügte. Stalin, der Vollstrecker, erscheint im Epigramm von 1933, das zur ersten Verhaftung des Dichters führte, wie in der „Ode“ von 1937 und den dazugehörenden 22 Gedichten, die zur zweiten Verhaftung führten, in seiner wahren Gestalt: der monströse Gigant, der Übermensch als der monumentale Einweihungs-führer, der Führer in die neue Welt. Die Ode auf Stalin wurde zur Ode auf die Hybris schlechthin, auf Vermessenheit und Überhebung, ein Preisgesang, der seinen Gegenstand rühmend vernichtete.
Vers für Vers zu verfolgen vom Eingang her, in dem der Gerühmte als die „Erdachse verschiebend“ auftaucht, bis in den Schlußteil, in dem der Rühmende, der Dichter, die Unverrückbarkeit der Welt bezeugt:
Mich wird man nicht mehr sehn, ich werd verschwindend klein –
In Kinderspielen, Büchern, zärtlichen Geschöpfen
Sag ich einst auferstehend, daß die Sonne scheint.
Deutsch von Ralph Dutli
Auf diese Weise rechnete sich Ossip Mandelstam stets zu den Einzuweihenden. Die Verfolgung durch das Wolfshundjahrhundert – ein Mißverständnis:
Den steigenden Zeiten zum höheren Ruhm,
Dir, Mensch, zur unsterblichen Glorie,
Kam ich, als die Väter tafelten, um
Den Kelch; gingen Frohsinn und Ehre verloren.
Mein Wolfshund-Jahrhundert, mich packts, mich befällts –
———
Denn ich bin nicht von wölfischem Blut, und mich fällt
Nur die ebenbürtige Hand.
Deutsch von Paul Celan
Seine berühmte Prophezeiung von 1931 ist Wort für Wort in Erfüllung gegangen:
Zeit wirds, ihr wißt, auch ich bin Zeitgenosse –
Ich bin ein Mensch der Konsum-Konfektion,
Seht, wie der Sakko sich an mir verbeult,
Wie ich zu schreiten weiß, und wie zu reden!
Versucht nur, reißt mich los von dieser Zeit,
Ich garantier, ihr brecht euch nur den Hals.
Deutsch von Hubert Witt
Das „Zu-Werden-Habende“, das, was werden soll, ist ohne Ossip Mandelstam nicht zu haben. Die globale soziale Architektur, die Weltwirtschaft als Welthäuslichkeit ist nur dann zum Wohle des Menschen zu denken, wenn im Sinne Mandelstams der „Kreis seiner häuslichen Freiheit ins Universale erweitert“ wird und nicht umgekehrt. Und da gilt am 24. Juni 2007 in Limlingerode wie am 7. Juni 1931 in Moskau:
Nicht aufgeregt sein: Ungeduld ist Luxus.
Ich werde sanft Geschwindigkeit entwickeln
Und kühlen Schrittes gehen wir auf die Bahn;
Meine Distanz – ich halte sie, wie immer.
Deutsch von Rainer Kirsch
„Ja, blutrotes Traumpferd, erscheine!“
Sergej Jessenin war und blieb eine russische Kultfigur
Dieser sanfte Jüngling mit dem strohblonden Haar, der aus einem unbekannten mittelrussischen Dorf aufgebrochen war, um in Petersburg Karriere zu machen und der beste Dichter des modernen Rußlands zu werden, der russische Bauernjunge, der eine weltberühmte amerikanische Tänzerin eroberte und mit ihr Europa und die USA bereiste, und sich, zurückgekehrt, in der Stadt seines spektakulären Beginns mit 30 das Leben nahm, bot den Stoff zum Kult.
Ein Dorfrüpel, der im Ton der mystisch-orgiastischen Hymnenpoesie der russischen Sekten sang, ein naiver Naturmensch mit tragischem Größenwahn, der Mann aus dem Märchen und aus der Skandalchronik, Verkörperung eines Mythos in der Banalität.
Die sowjetische Kulturpolitik hat dagegen anzugehen versucht, indem sie von Jesseninstschina sprach und damit die Nachahmung seines Lebens auf der untersten Stufe von Suff und Rowdytum brandmarkte. 1935 hatte Stalin Majakowski zum besten Dichter erheben wollen. Alles umsonst. Es gibt heute in Rußland Dutzende von größeren und kleineren Jessenin-Museen und Sammlerklubs. Es gab Jessenin-Bräute und Jessenin-Witwenkreise. Aber Jessenin wurde schon in den Kanon der sowjetischen Literaturgeschichte aufgenommen, als von Anna Achmatowa, Ossip Mandelstam kaum geredet werden durfte, geschweige denn von Nikolai Gumiljow oder Maximilian Woloschin.
Für mich war Sergej Jessenin von vornherein weniger eine Erscheinung der russischen Literaturgeschichte als vielmehr meines Existenzbezugs. Das erste, was ich über ihn erfuhr, stammt von Ilja Ehrenburg. Etwa 1955 las ich in der damals bedeutendsten europäischen Kulturzeitung Die literarische Welt den Nachruf Ehrenburgs auf Sergej Jessenin und darin den Satz: „Wo, wenn nicht in Rußland, mußte dieses Todeslied der unermeßlichen Äcker und Wiesen ertönen?“ Nicht, daß ich je Bauer gewesen wäre, aber die sächsischen Äcker und Wiesen sind mein Ausgang gewesen.
Und so hat es über die 55 Jahre viele Versuche gegeben, mich diesem Menschen zu nähern.
‒ Reise 1965 Jessenins Geburtsort Konstantinowo verpaßt – nur bis Rjasan gekommen.
‒ Leningrad 1966 Alexander Lohmann schenkt mir eine Jessenin-Ausgabe von 1916.
‒ In Moskau im Hotel gewohnt, wo auch Jessenin einst logierte.
‒ In Baku die Stelle aufgesucht, wo „Ersatz-Persien“ für Jessenin eingerichtet war.
‒ 1973 „Pugatschow“-Inszenierung in Moskau erlebt.
‒ Brief an Höpcke zu Gunsten des Sängers Biermann.
‒ Jessenin-Dissertation abgebrochen, dafür Aufsätze, Biographie 1992
Ja, blutrotes Traumpferd, erscheine!
Ja, blutrotes Traumpferd, erscheine!
In die Gabeldeichsel der Welt
eingespannt!
Streu über pazifische Ferne
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keller der Erinnerung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keller der Erinnerung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keller der Erinnerung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.