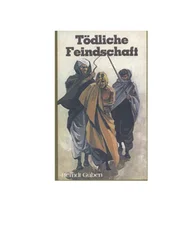Bisher war auf dem ganzen Zug kein Wort über den »Berg der bösen Geister« gefallen.
Ugawambi schien plötzlich vergessen zu haben, daß er nicht den Pfeifer führte, sondern Imi Bej.
Die vertraute Gegend, die in der Nähe vorbeiführende Lavastraße, das Dorf, in dem sie seinerzeit die erste Rast gemacht hatten, alles das zusammen wirkte so auf ihn, daß er gar nicht auf den Gedanken kam, man könnte eine andere Richtung als die zum Kilimandscharo einschlagen.
Und so erwiderte er denn ahnungslos auf Imi Bejs Frage:
»Wir können der Straße bestimmt ein Stück folgen. Später weiß ich dann schon den richtigen Weg. Wir müssen nur sehen, daß wir die nordwestliche Richtung nicht verfehlen.«
Imi Bej jubelte innerlich. Sein Vorhaben war gelungen. Nordwestliche Richtung, dachte er; nun, diese einzuhalten würde nicht allzu schwer sein.Ugawambi bekam plötzlich große Augen.
Erschrocken starrte er seinen Geschäftspartner an. Zum Teufel, wie war er nur auf den Gedanken gekommen, von einer ständigen nordwestlichen Richtung zu sprechen? Zwischen ihm und Imi Bej war doch nie die Rede von dem »Berg der bösen Geister« gewesen! Aber genau auf diesen Berg würde man stoßen, wenn man in der angegebenen Richtung weiterzog !
Ugawambi war verwirrt. Das Dschaggaland mit seinen saftigen fruchtbaren Matten und Hängen, die Königsstadt, das Volk selbst und der große, mächtige Berg standen greifbar nahe vor seinem inneren Auge.
Das Wort, dachte er, das Wort, das heilige Ehrenwort, das er dem Pfeifer gegeben hatte, nie etwas über den Kilimandscharo zu verraten! Was war aus diesem Wort geworden? Der Schwarze riß sich vor Verzweiflung die Perücke vom Kopf.
Aus all diesen Gesten entnahm Imi Bej, daß es ihm gelungen war, ihn zu übertölpeln.
Scheinheilig fragte er:
»Was hast du, Freund Ugawambi, ist dir nicht gut?«
»Ja — ja — nein, ich — ich weiß nicht — ich weiß wirklich nicht, ob wir nach Nordwesten ziehen sollten. Du hast doch nie über das Ziel deiner Reise mit mir gesprochen.«
»Mach dir keine Sorgen, die Richtung stimmt. Das weiß ich ganz genau.«
»Aber wir werden auf eine starke Streitmacht stoßen«, warf Ugawambi hastig ein. Er wollte retten, was noch zu retten war. »Die Wadschagga sind nicht Leute, die man einfach wegfangen kann.«
»Wer?« fragte Imi Bej.
»Die Wadschagga, jene Leute, die im Dschaggaland wohnen.«
»Ah, Wadschagga heißen die. Das ist interessant.«
»Ja, interessant schon; aber auch sehr gefährlich.«
»Inwiefern?«
»Der König der Wadschagga hat eine große Armee. Und die Bantu sind bei ihnen.«
»Bantu? Bantu-Neger gibt es doch nur an der Küste.«
»Ja, ja, das stimmt schon. Aber ein Stamm der Bantu ist zu den Wadschagga gezogen. Und diese Bantu haben Feuerwaffen.«
Imi Bej pfiff durch die Zähne.
»Wie sind sie dorthin gekommen?«
»Ich — das heißt, mein Massa und ich, wir haben sie dorthin geführt, damit sie dort in Ruhe und Frieden leben können.«
Imi Bejs Gesicht war eitel Sonnenschein. Seit langem war er nicht mehr so guter Laune gewesen wie heute.
»Was meinst du, wie lange es dauern wird, bis wir sie erreichen?«
Ugawambi sah alles verloren. Wie war es nur möglich, daß er sein größtes Geheimnis so unvermittelt preisgegeben hatte?
Imi Bej wußte nun, was er hatte wissen wollen. Sein Bedarf nach Unterhaltung war gedeckt. Der Satan überließ Ugawambi sich selbst und seinen Gedanken.
70
Der Pfeifer und Hassan jagten auf der Lavastraße nach Südosten. Links und rechts von ihnen war Urwald und Sumpf. Gegen Mittag dampfte die Gesteinsmasse, Regen und Hitze machten ein ebenso schnelles Weiterreiten unmöglich. Die Pferde waren so matt wie die Reiter.
Es blieb ihnen nichts übrig, als eine Rast einzulegen. Diese ungewollte Muße nahm Hassan zum Anlaß, um ein paar Fragen an den Pfeifer zu richten, die ihm schon seit langem auf der Zunge brannten.
»Wirst du mir böse sein, Sayd, wenn ich das Gebot der Höflichkeit durchbreche?«
Der Pfeifer lächelte.
»Ich glaube nicht, Hassan. Jeder Mensch ist berechtigt, auf Fragen, die er selbst nicht lösen kann, Antwort zu heischen.«
Hassan war ein wenig verlegen.
»Du redest eine ganz andere Sprache als die Menschen meiner Umgebung, obwohl du dieselben Worte gebrauchst«, erwiderte er.
»Das mag wohl sein. Jeder redet seine Sprache, die Sprache, die ihm geläufig ist.«
»Aber Abd el Ata zum Beispiel und all die anderen, sie reden die gleiche Sprache wie ich.«
»Ihr seid ja auch mehr oder weniger in derselben Umgebung aufgewachsen. Du weißt, daß ich aus Frankistan komme. Die Anschauungen Frankistans und die Anschauungen des Morgenlandes sind nun einmal verschieden.«
»So meinst du, daß die Franken weiser sind als wir?«
»O nein«, lachte Michel. »Von weise kann überhaupt nicht die Rede sein. Sie sind so wenig weise wie ihr.«
»Aber ihre Weisen sind weiser als unsere Weisen, nicht wahr?«
»Ein Mensch ist entweder weise oder er ist es nicht. Wer könnte von sich behaupten, daß er weiser sei als andere?«
»Ich glaube, ich könnte es von dir.«
»Du irrst, Hassan. Ich bin nicht weise.«
»Aber du bist anders.«
»Vermutlich auch anders als die anderen aus Frankistan.«
»Wer bist du eigentlich?«
»Ein Arzt, ein Hekim, den das Schicksal in die Welt getrieben hat, weil die Unvernunft in seinem Vaterland regiert.«
»Und so bist du ins Morgenland gegangen, weil du glaubtest, du würdest hier mehr Vernunft finden?«
»Vernunft ist überall«, sagte Michel. »Aber überall ist auch Unvernunft. Du kannst nicht einfach den Standort wechseln, um der Unvernunft zu entgehen und zur Vernunft zu gelangen.«
Hassan war ein aufgeweckter Junge; aber das Wortspiel, in das sich die beiden verfangen hatten, gefiel ihm nicht. Er wollte konkrete Dinge hören. Er wollte zum Beispiel wissen, aus welchem Grund der Pfeifer dazu kam, ein Gewehr zu besitzen, mit dem man ununterbrochen schießen konnte.
Und er war kühn genug, eine diesbezügliche Frage zu stellen.
Michel zögerte mit der Antwort. Sollte er dem Jungen die Wahrheit über den Mechanismus des Gewehrs erklären? Sollte er ihm die Illusion zerstören, daß er mit diesem Gewehr unbesiegbar war? Er entschloß sich, dies nicht zu tun; denn er sagte sich mit Recht, daß ein gut Teil seiner Autorität nur von seinem Gewehr abhing.
Diplomatisch antwortete er:
»Meine Muskete ist zwar ein wunderbares Gewehr; aber auch sie ist von Menschenhand erbaut worden. Ich schätze mich besonders glücklich, daß mich der Erfinderdieser Waffe für würdig genug hielt, ein Exemplar davon zu besitzen.«
»Ah, so gibt es noch mehr von dieser Sorte?«
»Sicher wird es noch mehr davon geben«, antwortete Michel. »Aber ich glaube nicht, daß der Erfinder viele davon aus der Hand gelassen hat.«
»Und warum gerade dir?«
»Er hielt mich seines Vertrauens für würdig. Er war der festen Überzeugung, daß ich diese fürchterliche Waffe nicht mißbrauchen würde.«
»Gibt es denn überhaupt Menschen, die ihre Waffen mißbrauchen?«
»O ja«, antwortete Michel. »Ist nicht jeder Krieg ein Waffenmißbrauch?«
»Habt ihr in Frankistan keine Kriege?«
»Leider, leider nur zu viele.«
»So! Und wenn ein Soldat auf den ändern schießt, dann ist das Mißbrauch?«
»Ich stehe auf dem Standpunkt, daß die meisten Fragen auf der Welt ohne Waffengewalt zu klären sind. Man könnte sich zum Beispiel irgendwo zusammensetzen, um sie zu diskutieren.
Für alle Dinge gibt es Lösungen — friedliche Lösungen.«
»Hieltest du es dann für richtig, wenn alle Waffen auf der Welt verbrannt würden?«
»Das ließe sich schlecht durchführen; denn es muß ja gejagt werden. Der Jäger braucht sein Gewehr.«
Читать дальше