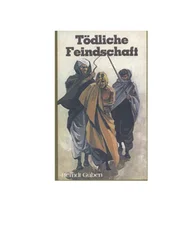»Aber solange es überhaupt Waffen gibt, werden die Menschen auch aufeinander schießen !«
Michel nickte ernst.
»Und warum tun sie das?« fragte er dann.
Hassan blickte lange nachdenklich vor sich hin.
»Ja, warum eigentlich?« fragte er und schwieg. »Siehst du«, sagte Michel, »das ist es, was auch ich nicht weiß. Einen Teil dieses Warums vermag ich zu beantworten. Es ist die Überheblichkeit der Menschen. Du und deine Freunde, zum Beispiel, ihr habt jahrelang andere Menschen gejagt, um sie in die Sklaverei zu verkaufen.«
»Das waren doch keine Menschen! Das waren Neger!«
»Da kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt. Wie kommst du dazu, die Neger für minderwertig zu halten?«
Hassan sah ihn erstaunt an.
»Wie ich dazu komme, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß sie minderwertig sind.«
Michel lachte bitter auf.
»Solche dumme Vorurteile haben sich durch Generationen in den Menschen festgesetzt. Sie sind nicht herauszubekommen. Nichts ist minderwertig, was lebt, denn sonst würde es nicht leben.
Alles, was da ist, erfüllt seinen Zweck. Die Tiere sind nicht minderwertig, weil wir sie erschießen. Wir sind einfach die Stärkeren und brauchen sie zur Nahrung. Ich kann mir nicht vorstellen, daß du zum Beispiel einen Büffel verachtest, nur weil er kein Gewehr handhaben kann.«
Hassans Augen blitzten.
»Ja«, sagte er, »siehst du, genauso ist es mit den Negern. Der Neger kann auch kein Gewehr handhaben, und wir fangen ihn, damit er für uns arbeitet. Das ist doch klar. Das ist logisch.«
»Das ist gar nicht logisch. Der Neger hat eine Seele wie du und ich. Er fühlt den Schmerz wie du und ich. Er sorgt im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Seinen, wie du für sie sorgst. Der Weiße, der ihm jetzt noch überlegen ist, ihr, die Araber, alle wollen mit dem Sklavenfang verdienen. Ihr verdient, indem ihr sie fangt und verkauft. Der Weiße verdient an ihnen, indem er die gekauften Sklaven als unentgeltliche Arbeitskräfte auf seinen Feldern oder Plantagen einsetzt. Hätte er sie nicht, so müßte er freie Arbeiter bezahlen. Der Unterschied zwischen arm und reich wäre dann nicht so groß, wie er tatsächlich ist, und gäbe nicht Anlaß zu erbitterten Kämpfen. — Sei mir nicht böse, wenn ich das Gespräch für diesmal beende; aber ich glaube es wird gut sein, wenn wir unseren Ritt fortsetzen. Die Pferde sind ausgeruht.«
Hassan nickte. Er hatte auch kein Bedürfnis, sich länger mit diesem seltsamen Mann zu unterhalten, dessen Thesen er nur halb verstand. Er würde viel darüber nachzudenken haben, um das zu verarbeiten, was er bisher vernommen hatte.
So stiegen sie wieder auf und ritten weiter.
Am frühen Nachmittag standen sie plötzlich am Ende der Lavastraße. Vor ihnen wogte der Urwald, dichter und undurchdringlicher als bisher.
»Hm«, machte Michel, »Abu Sef und Imi Bej scheinen diese Straße diesmal nicht benutzt zu haben.«
»Vielleicht sind sie noch nicht hier.«
»Das glaube ich nicht«, sagte Michel, »denn unser Weg war viel beschwerlicher und wohl auch länger als der ihre. Zudem hatten wir Tscham, dessen Krankheit uns immer wieder aufhielt.«
Sie wendeten die Pferde und ritten zurück. Jetzt allerdings ließen sie sich mehr Zeit, und Michel beobachtete ziemlich eingehend die Ränder der Straße. Plötzlich wurden sie eines Geiers ansichtig, der in nicht weiter Entfernung über dem Wald schwebte.
»Ich möchte doch sehen, was dort ist«, sagte Michel und stieg vom Pferd. Hassan folgte ihm.
Sie drangen von der Straße ab in das Gebüsch ein. Nach geraumer Zeit erreichten sie eine kleine Lichtung, auf der der Kadaver eines Pferdes lag. Das Tier zeigte Einschußwunden am Kopf.
Michel legte seine Hand auf den Leib und stieß einen leisen Ruf der Verwunderung aus. Der Kadaver war noch warm.
Er ließ seinen Blick umherschweifen und meinte nach kurzer Betrachtung:
»Hier sind Menschen gewesen, viele Menschen. Sieh dir das Pferd an. Es hat die linke Hinterhand gebrochen, und dann haben sie es erschossen.«
Die Spuren zeigten deutlich, daß hier ein Rastplatz gewesen sein mußte. Die Asche von vier Lagerfeuern war noch gut zu erkennen. Verkohlte Holzstückchen ragten heraus.
Als Michel den Rastplatz Schritt für Schritt absuchte, stellte er bald fest, nach welcher Richtung sich die Männer, die hier gelagert hatten, mit den Macheten in den Urwald gearbeitet hatten.
Obwohl Lianen und Schlinggewächse die Schnittstellen bereits zu überwuchern begannen, erkannte man sie bei deutlichem Hinsehen doch.
»Folgen wir vorsichtig der Spur«, sagte er zu Hassan.
Sie taten es und schufen sich mit den eigenen Haumessern Raum.
Es gab noch genügend kleine Anzeichen, die ihnen den Weg wiesen. Sie folgten ohne zu zögern und standen — auf der Lavastraße.
»Kannst du dir das erklären?« fragte Hassan.
Michel dachte nach. Da war der Lagerplatz, da war dasPferd, das noch wann war. Sie waren die ganze Lavastraße hinauf geritten, ohne die Spur eines Menschen zu finden. Die Karawane aber konnte nicht weit sein, wenn die Leichenstarre in dem Pferd noch nicht eingetreten war.
Ein Blitz durchzuckte Michels Gehirn.
Leichenstarre? Hatte er sich denn davon überzeugt, daß diese noch nicht eingetreten war? Er hatte den toten Körper nur befühlt. Und er war warm gewesen. Das Blut jedoch hatte längst aufgehört, aus der Stirnwunde zu sickern. Und warm? Was war bei dieser Temperatur nicht warm?
Der Geier? Weshalb war er nicht niedergestoßen auf das tote Pferd?
Michel zog sein Fernrohr aus der Satteltasche, zog es auseinander und richtete es auf die Stelle, wo er vorher den Geier bemerkt hatte. So sehr er auch den Himmel absuchte, von dem Vogel war nichts mehr zu sehen. War er im Beginn seiner Mahlzeit vielleicht nur durch ihr Erscheinen gestört worden?
»Wir müssen zurück«, sagte der Pfeifer fest. »Ich muß mich davon überzeugen, wie lange das Pferd schon tot ist.«
Sie machten sich auf den beschwerlichen Rückweg. Die Sonne stand schon tief im Westen, als sie wieder neben dem Kadaver standen. Michel untersuchte das Tier.
Der warme Körper dampfte vor Feuchtigkeit. Auf den ersten Blick mußte es tatsächlich den Anschein haben, als sei das Pferd vor etwa zwei Stunden erschossen worden.
»Hast du etwas entdeckt?« fragte Hassan.
Michel richtete sich auf.
»Ja. Das Tier ist seit mindestens vier Tagen tot. Und ich behaupte, daß sich auch der Geier von dem warmen, dampfenden Fell hat täuschen lassen.«
»Vier Tage tot?« fragte Hassan überrascht.
Michel nickte bestätigend.
»Das heißt«, fuhr Hassan fort, »daß sie, wenn sie ständig auf der Lavastraße geblieben sind, zwei Tage Vorsprung haben?«
Michel nickte.
»Mindestens zwei Tage. Wenn sie schnell geritten sind, drei.«
»Und bis wohin geht die Straße? Wo endet sie?«
»Das kann ich nicht genau sagen. Vermutlich jedoch dürfte sie nicht allzu lang sein. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die, die wir verfolgen, das Ende der Straße längst hinter sich haben.«
»Und was tun wir jetzt?«
»Wir reiten zurück. Ich muß mir überlegen, was zu tun ist.«
71
Während ihre Pferde dahinflogen, dachte Michel an Ugawambi. Er würde ihm gehörig den Kopf waschen, sollte er ihn je wieder treffen. Der Pfeifer war sich der Gefahr bewußt, in der das ganze Volk im Dschaggaland schwebte.
Für ihn stand es jetzt fest, daß Imi Bej und Abu Sef vorhatten, bis zum Berg des ewigen Schnees vorzudringen. Und Imi Bej und seine Leute würden bestimmt nicht als Freunde zu den Wadschagga kommen. Mit Schrecken malte sich Michel aus, wie die herrliche Königsstadt aussehen würde, wenn Imi Bejs Leute darin gehaust hatten. Freilich, auch Baluba und sein Volk lebten dort. Und sie hatten einige Gewehre. Es waren, wie sich Michel erinnern konnte, höchstens acht bis zehn intakte Flinten. Ob die Eingeborenen damit umgehen konnten, blieb allerdings dahingestellt.
Читать дальше