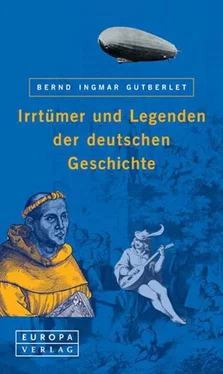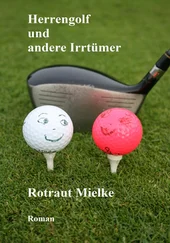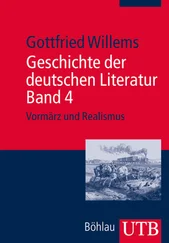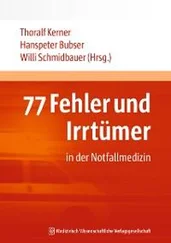Bernd Ingmar Gutberlet - Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernd Ingmar Gutberlet - Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Als Papst Urban II. zum ersten Mal zum Kreuzzug aufrief, ging es ihm um die Befreiung der Heiligen Stadt, um Hilfe für die Glaubensbrüder im Osten, aber nicht um eine Herrschaft über das Heilige Land. Vielmehr sah man sich genötigt, dem islamischen Expansionsdrang etwas entgegenzusetzen. Muslimische Truppen hatten Europa schon mehrfach bedroht, immerhin stand bereits ein großer Teil der iberischen Halbinsel unter islamischer Herrschaft. Die römische Kirche war nicht darauf aus, den Islam zu besiegen, abgesehen von der Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens war man auch sonst eher an einer friedlichen Koexistenz interessiert. Von der Absicht, einen Religionskrieg zu führen, kann daher keine Rede sein. Jenseits des Mittelmeeres saß der Islam, dessen Existenzrecht außer Frage stand, aber Europa gehörte dem christlichen Gott, ebenso Jerusalem, daran gab es nichts zu deuteln.
Schon bald hatten die Kreuzzüge nicht mehr nur Jerusalem und das Heilige Land im Visier: Außer gegen die islamische Herrschaft auf der iberischen Halbinsel und gegen Ketzer überall in Europa, zogen Kreuzfahrer auch nach Deutschland: entweder um die Slawen im Osten gewaltsam zu christianisieren, oder gegen die Staufer, so 1199 gegen den Reichsministerialen Markward von Annweiler und Jahrzehnte später gegen Kaiser Friedrich II. selbst und seine Nachfolger. Denn das Papsttum hatte den Nutzen der Kreuzzugsidee für den eigenen politischen Vorteil bald erkannt. Rom nutzte die Schlagkraft und Popularität der Kreuzzugsidee, um im christlichen Europa eigene Interessen erfolgreich durchzusetzen und Gegner wirkungsvoll zu diskreditieren - und auch offen zu bekämpfen.
Schließlich muss noch die Vorstellung korrigiert werden, Kreuzzüge habe es nur im Mittelalter gegeben. Zwar stammt die Idee aus dem Mittelalter, aber auch spätere Päpste verkündeten Kreuzzüge: etwa gegen die englische Reformation - die spanische Armada Philipps II. segelte 1588 im Namen des Kreuzes gen England - oder noch bis 1699 wiederholt gegen die Muslime.
Friedrich Barbarossa.
»... und wird einst wiederkommen«?
Hoch oben auf der Spitze des Kyffhäuser erheben sich die Ruinen der gleichnamigen Reichsburg, ehemals in ganzer Pracht stolz die Bergkette überragend. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ergänzt ein Denkmal die Ansicht: das Kyff-häuser-Denkmal, das Kaiser Wilhelm zusammen mit dem rotbärtigen Staufer Friedrich Barbarossa zeigt, Letzterer als Erwachender dargestellt, im Krönungsmantel und mit Kaiserkrone. Ein anderes Monument der Zeit sind die beiden Reiterstandbilder Wilhelms und Barbarossas vor der Goslarer Kaiserpfalz, ein trautes Kameradenpaar hoch zu Ross.
Barbarossa starb, durchaus noch ein rüstiger älterer Herr, auf dem dritten Kreuzzug 1190, weitab der Heimat. Sein Leichnam sollte in Jerusalem beigesetzt werden, verschwand aber irgendwo auf dem Weg spurlos. Vielleicht waren dieser geheimnisvolle Tod und das weitere Schicksal seiner sterblichen Überreste der eigentliche Ursprung einer Sage, die sich seit Anfang des 16. Jahrhunderts um den Stauferkaiser rankt und sich im 19. Jahrhundert großer Popularität erfreute - so dass ein deutsches Nationaldenkmal für den Kaiser der Reichsgründung von 1871 wie selbstverständlich einen sieben Jahrhunderte früher lebenden Vorgänger gleichfalls ehrte. In Anspielung auf den rotbärtigen Staufer wurde Wilhelm I., der auch einen Bart trug, »Barbablanca« genannt. Reichskanzler Bismarck setzte 1878 sogar eine Forschergruppe in Gang, um in Kleinasien nach dem Grab des Kaisers zu suchen - ohne Erfolg.
Um eine Erklärung dafür war die Legende nicht verlegen: Ihr zufolge war Barbarossa auf dem Kreuzzug gar nicht gestor-ben, sondern lebte weiter, nämlich im Inneren des an Höhlen reichen Kyffhäuser. Dort, so die Erzählung, sitze er an einem Tisch und erwarte, halb wach, halb schlafend, den Zeitpunkt seiner Rückkehr, während sein Bart einstweilen wachse und wachse - durch die Tischplatte hindurch. Ein hübsches Motiv, das natürlich reichhaltige künstlerische Verwendung fand - und zu sehr witzigen politischen Karikaturen führte. Im »Volksbüchlein von Kaiser Friedrich« von 1519 heißt es, der Kaiser sei »verloren gegangen« und niemand wisse so recht, wo er hingekommen sei, aber manche behaupteten, er sei am Leben und würde in einem hohlen Berg auf seine Rückkehr warten. Nicht nur im Kyffhäuser vermutete man den alten Herrn, sondern auch in einer steinernen Höhle bei Kaiserslautern oder in der Nähe von Salzburg. Die Brüder Grimm wähnen ihn im Thüringischen. Sie wissen außerdem von mehreren Versionen der Sage: In manchen, so erklären sie, wachse der Bart durch den Tisch, in anderen um ihn herum. Und solange noch Raben um den Berg flögen, würde Barbarossa nicht zurückkehren und seine Mission erfüllen.
Die erst lange nach seinem Tod entstandene Mär vom Kaiser, der zurückkehren und sein Volk in eine Zeit von Ruhm und Frieden führen würde, bezog sich ursprünglich gar nicht auf Barbarossa, sondern auf seinen Enkel, Kaiser Friedrich II., der 1250 starb. Mehr noch als an seinen Großvater knüpften sich im späten Mittelalter an den jüngeren Friedrich Hoffnungen auf seine Wiederkehr als Friedenskaiser, der mit einem tausendjährigen Reich das in der Bibel vorhergesagte Ende der Welt einläuten würde. Freilich gab es auch die päpstliche Partei, die das strahlende Herrscherbild des erbitterten Gegners, gegen den zu Lebzeiten immerhin ein Kreuzzug ausgerufen worden war, zu demontieren versuchte. Sie zeichnete das Bild vom Antichristen, das krasse Gegenteil des Friedenskaisers.
Mit Barbarossa als Hauptdarsteller aber überlebte die Sage vom wiederkehrenden Kaiser das Mittelalter. Seit 1815, als Napoleon zum Abtreten gezwungen worden war und die Deutschen allmählich ein Nationalgefühl zu entwickeln begannen, wurde die Sage von Barbarossa zu einem beliebten literarischen Sujet mit politischem Hintergrund. Auf dem Kyffhäuser fand während der Revolution von 1848 eine Feier statt, bei der sich thüringische Patrioten in einem eigens verfassten Gedicht der Zustimmung des alten Kaisers zu ihrer Erhebung versicherten. Damals begannen Vereine im schwäbischen Stammland Barbarossas, das Adelsgeschlecht als Namensgeber zu erwählen. Noch heute gibt es Vereinswappen, die den Berg abbilden, Philatelisten, die sich nach den Staufern benennen, oder Ruderer, die mit dem Schlachtruf: »Staufen, Staufen in die Riemen!« ihren Herausforderern davonfahren.

Kaiser Friedrich I. Barbarossa als Kreuzfahrer.
Das Herrschergeschlecht der Staufer, das den Glanz des deutschen Mittelalters und den Stolz des deutschen Kaisertums verkörperte, erwies sich bald als ausgesprochen geeigneter historischer Bezugspunkt bei der Gründung des Deutschen Reiches 1871 durch Wilhelm I. und seinen Kanzler Bismarck. Gerade Barbarossa taugte vortrefflich als Projektionsfläche für eine nationale Stimmung. Aber der Stauferfürst diente auch als Ahnherr und lieferte Ideen für Symbolpolitik. Als beispielsweise Kaiser Wilhelm II. 1898 nach Palästina reiste, bestand er darauf, die Strecke Haifa-Jerusalem hoch zu Ross zurückzulegen - wie seinerzeit Barbarossa als Kreuzritter. Und natürlich fanden die ungezählten Gedichte um den Rauschebart-Kaiser im Berginnern Eingang in die Schulbücher des Kaiserreichs.
Aus heutiger Sicht mag es befremdlich bis lächerlich wirken, wenn die Hohenzollern unbekümmert in die Fußstapfen der mittelalterlichen Vorgänger traten und in den vielen Denkmälern mit großer Geste die Vergangenheit bemühten. Aber das war harmlos im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Denn die Nationalsozialisten nutzten den Staufermythos eifrig für ihre Propaganda, sei es durch »Sonnwendfeiern« der Hitlerjugend in der Barbarossakirche von Hohenstaufen oder durch einen historischen Umzug, der aus Anlass der Eröffnung des »Hauses der Deutschen Kunst« 1937 in München stattfand. Ganz zu schweigen vom »Unternehmen Barbarossa«: Auf persönliche Veranlassung Hitlers wurde ein anderer Titel für die militärische Operation zum Überfall der Sowjetunion 1941 kurzerhand abgesetzt. Hitler bestand auf einem Verweis auf Kaiser Rotbart - ob er damit einen neuen Kreuzzug anzeigen wollte oder den »Aufbruch Gesamteuropas gegen den (roten) Bolschewismus«, wie die Nazipropaganda tönte, sei dahingestellt. Jedenfalls war der nationale Staufer-mythos dadurch vollends diskreditiert. In diesem Sinne endet denn auch Günter Kunerts »Neuere Ballade infolge älterer Sage«:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.