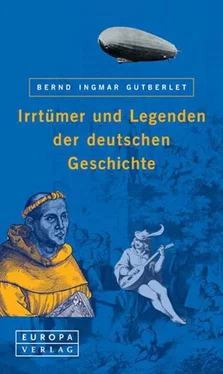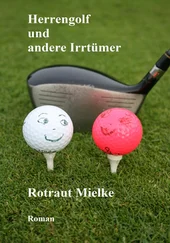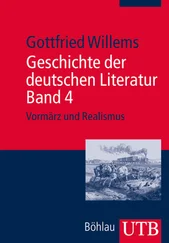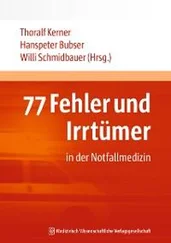Bernd Ingmar Gutberlet - Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernd Ingmar Gutberlet - Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Menschen der ersten Jahrtausendwende waren von Ängsten geprägt, wie die Menschen anderer Epochen auch. Der Tod war im Mittelalter stets präsent und im Gegensatz zu heute kein Tabu. Biblische Schrecken waren konkret, und Anzeichen für göttliches Wirken oder das nahende Ende der Welt glaubte man immer wieder zu erkennen. Diese Haltung prägte das gesamte Mittelalter, und das Jahr 1000 nimmt keine Sonderstellung ein.
Im Übrigen war die Zeitwahrnehmung damals weniger an Jahren ausgerichtet als an wiederkehrenden kirchlichen Festtagen. Die kalendarischen Abweichungen waren sehr groß, die römische Zeitrechnung war weit weniger verbreitet als heute (vgl. S. 11 ff). Die Ostkirche mit dem Zentrum Byzanz zählte im römischen Jahr 1000 nach griechischer Tradition das Jahr 6508, der Islam 390, die jüdische Welt 4706. Ganz abgesehen davon, dass der Jahresbeginn an ganz unterschiedlichen Tagen begangen wurde. Aber selbst innerhalb der westlichen römischen Kirche lag die Sache nicht so eindeutig. Zum Teil zählte man noch nach antiker römischer Tradition, also ab der Gründung der heiligen Stadt 753 vor Christus. Und die Berechnungen über das Jahr von Christi Geburt lagen bis zu 50 Jahre auseinander. Natürlich ist auch heute nicht gesichert, wann Jesus geboren wurde. Für den Millenniumsrummel vor wenigen Jahren spielte das allerdings keine Rolle, da ging es um die bloße »Magie« des Kalenders. Im Mittelalter aber ging es ganz konkret darum, wann welche Voraussagen der Bibel eintreffen würden.
Bussgang nach Canossa.
Königliche Niederlage?
Drei Nächte und drei Tage hatte der König im Büßergewand vor den Toren gestanden, barfuß, in bitterster Winterkälte. Es war Ende Januar 1077, als Heinrich IV., deutscher König, nach Italien gereist war, um den Papst in tiefer Reue dazu zu bewegen, Exkommunikation und Kirchenbann zurückzunehmen, die der Heilige Vater über den widerspenstigen Herrscher ausgesprochen hatte. In den Augen des Papstes, der den uneingeschränkten Anspruch erhob, geistliches Oberhaupt der Christenheit zu sein, war der deutsche König häufig ungehorsam gewesen. Konkreter Anlass für den folgenreichen Kirchenbann war die Besetzung des begehrten Mailänder Bischofssitzes. Zum Eklat war es gekommen, weil Heinrich den Einspruch Gregors gegen seine Personalpolitik ignoriert hatte.
Ein Kirchenbann war damals eine ernst zu nehmende Angelegenheit: Er bedeutete nicht einfach die Verweigerung des heiligen Abendmahls oder des Beichtsakraments. Es war vielmehr der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gläubigen: Geistlich gesehen hatte der König selbst sozusagen den wenig attraktiven Status eines Vogelfreien. Ein Herrscher konnte sich das nicht leisten, da seine Autorität erheblich beschädigt wurde. Die Untertanen befreite der Bann vom Treueid dem König gegenüber; sogar der Aufenthalt mit ihm unter einem Dach war nach dem Bannspruch, streng genommen, verboten.
Schon Mitte Dezember war Heinrich in Speyer aufgebrochen und hatte sich mit Frau und Sohn auf die beschwerliche Reise nach Italien gemacht. Gregor VII. hatte sich zunächst geweigert, ihn in Rom zu empfangen, daher war Heinrich ihm entgegengereist. Voller Demut wartete er nun vor der Burg von Canossa, dem Quartier des Papstes, der sich schließlich des armen Sünders erbarmte und ihn in den Schoß der Kirche zurückholte. Heinrichs Bußgang war eine bedingungslose Kapitulation vor der Autorität des Papstes, ein Akt der Unterwerfung.

Nach der Überlieferung war es die Markgräfin von Tuszien, die den Papst bestürmte, Heinrich IV. zu empfangen und vom Bann zu lösen.
So weit die Überlieferung. Näher beleuchtet, ist diese altbekannte Darstellung allerdings nicht korrekt und ziemlich tendenziös. Auch wenn man heute noch bei einer reuevollen Abbitte oft im übertragenen Sinn von einem »Bußgang nach Canossa« spricht - so demütigend, wie es scheint, war die Angelegenheit für Heinrich nicht. Er dürfte auch kaum drei Tage lang ununterbrochen in der Kälte verharrt haben, bis die päpstlichen Ratgeber Gregor überredet hatten, dem König die Absolution zu erteilen. Vielmehr hat er an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Büßergewand beim Papst vorgesprochen, und war erst am dritten eingelassen worden. In der Tat hatte sich der bis zum Starrsinn eigenwillige Gregor erst auf längeres Drängen seiner Ratgeber bereit erklärt, den König einzulassen.
Zwar sind die äußeren Daten der Beschreibung richtig, aber das Bild des Königs als reuiger Sünder ist nur ein Aspekt des Geschehens. Mittelalterliche Politik war zu großen Teilen Symbolpolitik. Mit dem Auftreten im Büßergewand entsprach Heinrich den kirchlichen Bestimmungen der Bußpraxis, um so die Aufhebung der Exkommunikation zu erreichen. Ehrenrührig war ein solcher Schritt aber nicht. Heinrich zeigte sich demütig und trug dadurch einen Sieg davon: Denn abgesehen davon, dass der Papst selbst ihm die Absolution erteilte, wendete Heinrich auch eine drohende Gefahr ab. Der Heilige Vater befand sich nämlich auf dem Weg nach Augsburg, wo am 2. Februar ein Reichstag stattfinden sollte. Die mit Heinrich tief zerstrittenen deutschen Fürsten beabsichtigten, den Papst für ihre Position und gegen den König zu gewinnen. Das hätte den König mehr als kalte Füße im Schnee gekostet - womöglich die Krone. Doch so war Heinrich den Fürsten zuvorgekommen und hatte mit seinem »Bußgang« einen Coup gelandet, der ihm politisch nutzte: Der Papst reiste nicht nach Deutschland, Heinrich war sozusagen rehabilitiert und hatte seine Handlungsfähigkeit wiedergewonnen. Er hatte einen taktischen Sieg errungen, auch wenn er als reuiger Verlierer dastand. Da tat es erst mal wenig zur Sache, ob er dem Ansehen und dem Status des deutschen Königtums durch die symbolische Unterwerfung unter den Papst Schaden zugefügt hatte.
Keuschheitsgürtel
Ausgeburt männlicher Eifersucht?
Im Jahr 1931 beschreibt ein Engländer das Thema seines Buches als »eines der merkwürdigsten Dinge, die die männliche Eifersucht je hervorgebracht hat«. Ob als Venusband oder italienisches Schloss, Jungfrauengürtel oder Schloss der Eifersüchtigen - der Keuschheitsgürtel hat die Fantasie vieler Männer, zumal Künstler, beflügelt. Der kundige Engländer vermutet, mittelalterliche Kreuzfahrer hätten die Idee von ihren Orientreisen mit nach Europa gebracht. Und natürlich konnte man sich bei jahrelanger Abwesenheit durch einen Kreuzzug eher auf ein entsprechendes technisches Gerät verlassen als auf Treueschwüre der Gattin. Demzufolge soll es Ehefrauen gegeben haben, die die mitunter jahrelange Absenz ihrer Männer mit einem nicht nur Sex verhindernden, sondern auch ziemlich unbequemen Gerät um die Hüften verbringen mussten.
Die Vorstellung von eisern gegürteten Damen, die den Lockungen der Minnesänger nur sehr begrenzt verfallen können, ist sehr verbreitet. Noch heute gilt der Keuschheitsgürtel als eines der vielen Symbole für die Unterdrückung der Frau im Mittelalter oder er dient vorzugsweise Männern als erotische Projektionsfläche.
Dass Keuschheitsgürtel, so seltsam sie auch anmuten mögen, kein Hirngespinst sind, belegt ein Blick in Kataloge des Sexhandels. Dort gelten sie allerdings als Lustgewinn versprechendes Erotik-Utensil. Und viktorianische Dienstmädchen des 19. Jahrhunderts sollen sich mittels dieser Gerätschaft, die mit einem Hüftband und einem vertikalen Metallriegel den Zugang zum weiblichen Geschlechtsorgan verhinderte, gegen allzu freche Avancen ihrer Dienstherren zur Wehr gesetzt haben.
Für das Mittelalter lässt sich jedoch der Gebrauch von Keuschheitsgürteln nicht nachweisen. Angeblich mittelalterliche Stücke, die in Museen ausgestellt waren, erwiesen sich bei genauerer Prüfung als Fälschungen aus dem 19. Jahrhundert. Man entfernte sie rasch aus den Vitrinen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.