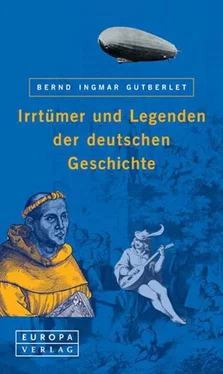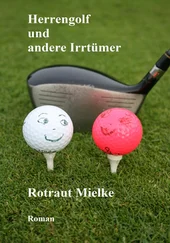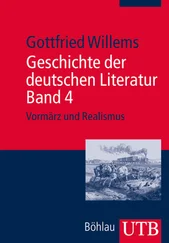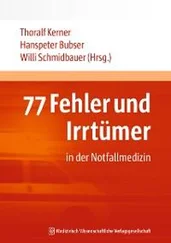Bernd Ingmar Gutberlet - Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernd Ingmar Gutberlet - Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das war schon im Mittelalter ähnlich. Ob man einen solchen Skandal für möglich oder gar authentisch hielt, richtete sich auch danach, wie man Kirche und Religion seiner Zeit erlebte. Immer wieder gab es Perioden, in denen vermehrt Kritik am Papsttum laut wurde. Solche Kontroversen wurden auch propagandistisch ausgetragen, etwa in den Schriften der Bettelorden. Die Bettelorden, die in Abgrenzung zur reichen Kirche die Armut als oberstes Ideal verstanden, agitierten gegen den Heiligen Stuhl, und sie waren dem Volk - allein durch räumliche Nähe in ihren städtischen Konventen - sehr viel näher als der Papst in Rom. Die meisten Autoren, die über Johanna schrieben, waren Bettelmönche.
Es ist auch kaum verwunderlich, dass im 16. Jahrhundert, in den stürmischen Jahrzehnten nach der Reformation, die Geschichte von Johanna in den protestantischen Polemiken gegen die katholische Kirche und das Papsttum häufig als Beispiel für die verlotterte römische Kirche angeführt wurde. Auch den Protestanten diente die Frau auf dem Stuhl des hl. Petrus als anschauliches Sinnbild katholischer Verderbtheit.
Aber wie steht es nun mit den angeblichen Indizien? Die seltsamen Stühle, die gemiedene Gasse, der Grabstein? Wie bei vielen Legenden lassen sich auch im Falle der Päpstin Johanna Details, auf die sich Wahrheitsnachweise stützen, plausibel und unspektakulär erklären.
Die Stühle, deren anatomische Besonderheit lange damit erklärt wurde, man prüfe so die Viriliät des neu gewählten Papstes, stammen aus der Antike. Sie waren aus Rosso Antico, einem Stein, der wegen seiner roten Farbe dem Porphyr, dem »kaiserlichen Stein«, gleichgesetzt wurde. Farbe und Alter dürften die beiden Möbel für die Verwendung bei der Inthronisation qualifiziert haben. Dass die Sitzflächen eine Aus-sparung aufwiesen, hat einen ganz praktischen Grund: Die steinernen Sitzgelegenheiten dienten als Badesessel, was die Aussparung der Sitzfläche vergleichsweise banal erklärt: Das Wasser konnte abfließen.
Und auch dafür, dass Papst und Gefolge eine bestimmte Gasse nicht benutzten, obwohl sie eine Abkürzung auf einem häufig zurückgelegten Weg bot, gibt es eine ganz simple Erklärung: Diese Gasse war so eng, dass der Papst und sein Gefolge gar nicht hindurchgepasst hätten. Daher nahm man einen längeren, für eine kleine Prozession aber bequemeren Weg.
Die Statue, die leider nicht mehr existiert, stellte einigen Zeugnissen zufolge keineswegs so eindeutig eine Frau mit Kind dar: Zeitdokumente, die sich nicht auf die Päpstin-nenlegende beziehen, sprechen von einer Priestergestalt mit Palmenzweig, sowie einem dienenden Knaben. Weil die Figur aber ein weites Gewand trug, konnte man sie leicht für eine Frau mit Kind halten.
Die rätselhafte Inschrift auf einem Stein, der sich ebenfalls in der Gasse befand, lässt sich nur mit einer gehörigen Portion Fantasie auf die Päpstin beziehen. Denn solche Inschriften bestanden überwiegend aus uneindeutigen Abkürzungen, in diesem Fall sechsmal der lateinische Buchstabe P. Natürlich lässt sich daraus ein lateinischer Satz bilden, der auf die Sage passt. Aber andere Auslegungen dieser Inschrift sind wahrscheinlicher. Lateinische Inschriften, die schwer zu deuten waren, wurden im Mittelalter gerne für Wortspielereien verwendet.
Auch die konkrete Angabe, Johanna sei in Mainz geboren, ist eher als Indiz dafür zu werten, dass die Legende vornehmlich ideologisch begründet war. Mainz war zur Zeit der Entstehung der Johanna-Legende die deutsche Metropole und Synonym für die Rivalität zwischen Papst- und Kaisertum. Später diente Johannas deutsche Herkunft als Erklärung, warum kein Deutscher mehr zum Papst gewählt wurde - was einige deutsche Autoren dazu brachte, die Legende ganz nach Griechenland zu verlegen. Auch das Detail des Studiums in Athen ist zweifelhaft, denn die ehemals glanzvolle Metropole Griechenlands war zur Zeit Johannas längst kein herausragender Ort der Wissenschaften mehr.
Noch ein bemerkenswerter Aspekt deutet auf den Legendencharakter der Päpstinnengeschichte: Eine sehr ähnliche Geschichte wird auch aus dem orthodoxen Byzanz, dem Sitz der Ostkirche, berichtet. Ein Patriarch des 10. Jahrhunderts soll demnach seine Nichte als Mann verkleidet zu seinem Nachfolger gewählt haben lassen. Und nicht zuletzt dürfte eine römische Lokallegende Pate gestanden haben. Sie erzählt von der öffentlichen Geburt eines Kindes in einer Gasse zwischen Kolosseum und San Clemente.
Es verhält sich mit der Legende der Päpstin Johanna also ähnlich wie mit vielen Verschwörungstheorien. Entsprechend interpretiert, dienen diverse Details als Indizien für die Richtigkeit einer Annahme. Zusammengenommen ergibt sich ein Zirkelschluss dieser Hinweise, der dann mit einem Beweis gleichgesetzt wird. Tatsächlich aber stützen mehrere auf Sand gebaute Säulen ein dementsprechend instabiles Argumentationsgebäude, das bei einiger Nachforschung rasch ins Wanken gerät. Auch wenn sich nicht belegen lässt, dass keine Frau jemals Papst war - die vagen und widerlegbaren Hinweise reichen für eine Beweisführung ihrer Existenz noch viel weniger aus.
Das Jahr 1000
»... heia, geht die Welt zugrund'«
Als das 20. Jahrhundert sich dem Ende zuneigte, erwachte auch das Interesse an früheren Jahrhundertwechseln wieder -und insbesondere an der Jahreswende 999/1000, als die Menschen schon einmal ein neues Millennium begrüßt hatten. Wie taten sie das?
Nach verbreiteter Auffassung fürchteten sich die Menschen des 10. Jahrhunderts vor dem Wechsel, weil sie mit dem Weltuntergang rechneten. Den Christen des Mittelalters war die Apokalypse des Johannes im letzten Buch des Neuen Testamentes durchaus geläufig. Dort ist vom Schrecken des Weltendes die Rede und vom anbrechenden Tausendjährigen Reich, und diese Situation schien den Menschen damals sehr konkret.
1833 schrieb der französische Historiker Michelet über die Ängste der mittelalterlichen Menschen in Europa angesichts dieser Prophezeiungen und der um sie herum stattfindenden Katastrophen vor dem Jahrtausendwechsel.
Felix Dahn (»Ein Kampf um Rom«) veröffentlichte 1889 einen Roman über das Jahr 1000 mit dem Titel »Weltuntergang«, wo es heißt: »Morgen um die zwölfte Stund', heia, geht die Welt zugrund'.« Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Vorstellung, die Menschen des Mittelalters wären aus Furcht vor dem Jahr 1000 auf ihren Kirchenbänken hin und her gerutscht, besonders populär. Aber auch einhundert Jahre später wird ein solches Schreckensbild noch gerne gemalt.
Was jedoch Michelet und seine Kollegen vermuteten und viele kritiklos übernahmen, das sehen Historiker heute anders.
Zwar spielt die Zeitspanne von tausend Jahren in der christlichen Erwartung des Weltendes eine wichtige Rolle. Aber das heißt noch lange nicht, dass man just das Jahr 1000 für den Anfang vom Ende gehalten hätte. Man versuchte, trotz entsprechender Verbote seitens der Kirche, das Weltende nach den Angaben aus der Bibel zu berechnen, aber die Ergebnisse lagen weit auseinander. Außerdem gab es schon damals Warnungen davor, Zeitangaben des Alten und des Neuen Testaments wörtlich statt symbolisch zu verstehen.
Um die erste Jahrtausendwende nach Christi Geburt kursierten durchaus Spekulationen über die Apokalypse und das neue Reich - allerdings nicht mehr als zu anderen Jahren. Man verband mit dem Jahr 1000 keine besondere Erwartung. Andernfalls hätten Klosterchroniken, die von entsprechenden Ängsten durchaus berichten, in den 990er Jahren Vergleichbares enthalten. Das ist aber nicht der Fall. Ein anderes Indiz liefern die beiden mächtigsten Männer der damaligen Zeit, Kaiser Otto III. und Papst Silvester. Diese sehr gelehrten und eng befreundeten Männer beschäftigten sich ebenfalls mit dem Thema, äußerten sich indes nie besorgt über die nahende Jahrtausendwende. Sie gingen bei der Berechnung der Apokalypse nicht vom Geburtsjahr Jesu aus, sondern vom Zeitpunkt seines Todes.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.