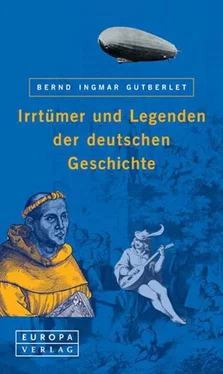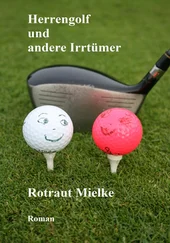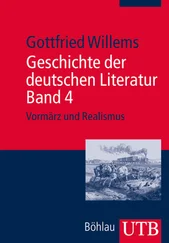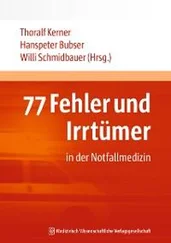Bernd Ingmar Gutberlet - Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernd Ingmar Gutberlet - Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Zwar ist bekanntermaßen die christliche Zeitrechnung die am weitesten verbreitete auf der Erde, aber es gibt noch andere Zählungen der Zeit, andere Kalender. Die christliche Zeitrechnung, wie wir sie noch heute benutzen, wurde erst im 6. Jahrhundert nach Christus eingeführt. Und selbst dann dauerte es noch Hunderte Jahre, bis sie sich auch nur im Abendland bis in den abgelegensten Winkel, bis zum letzten Klosterschreiber und Stadtchronisten durchsetzen konnte. Die Zählung vom Nullpunkt rückwärts, also die Angabe vorchristlicher Jahre, ist sogar noch jünger, denn bis in die Neuzeit hinein rechnete man für die Zeit vor Christi Geburt ab dem - zugegebenermaßen aus heutiger Sicht höchst zweifelhaften - Zeitpunkt der göttlichen Schöpfung, der Erschaffung der Welt.
Bevor die christliche »Sekte« unter dem römischen Kaiser Konstantin Anfang des 4. Jahrhunderts Staatsreligion wurde, hatte die verfolgte Minderheit kaum damit rechnen können, dass sich ein christlich orientierter Zeitmaßstab jemals so umfassend durchsetzen würde, wie das für uns heute selbstverständlich ist. Wäre dem Judentum ein ähnlich ausgeprägtes Missionsbewusstsein eigen, hätte es damals dem Christentum den Status der dominierenden Religion des Abendlandes durchaus noch streitig machen können - und heute gälte der jüdische Kalender als universelle Zeitrechnung. Außerdem sah man das Leben Jesu zunächst in Verlängerung der biblischen Zeitrechnung, erkannte also keine Notwendigkeit, eine »Stunde null« kalendarisch festzulegen.
Das tat man später, nachdem die Geburt Christi mehr und mehr als eine Zeitenwende verstanden wurde, die auch kalendarisch zu würdigen war. Aber es gab nie ein Jahr null, das einer solchen »Stunde null« entsprochen hätte. Das hat seinen einfachen Grund darin, dass sich das Christentum in der römischen Welt etablierte und daher Latein als Sprache mitsamt dem lateinischen Zählsystem übernahm. Unter den römischen Ziffern gibt es aber keine Null, daher gab es, auch in der rückwirkenden Zählung, kein Jahr null. Die arabischen Zahlen wurden in Europa erst gegen Ende des Mittelalters eingeführt. Die Frage, wann denn dann Jesus geboren wurde, ist ohnehin nicht eindeutig zu beantworten - vermutlich mehrere Jahre vor dem Zeitpunkt, an dem die ihm gewidmete Zeitrechnung beginnt. Die ersten Berechnungen, um die christliche Zählung auch am richtigen Datum einsetzen zu lassen, waren nämlich fehlerhaft.
Aus diesem Grund begann das dritte nachchristliche Jahrtausend am 1. Januar 2001 und nicht ein Jahr zuvor: Erst mit Ablauf des 31. Dezember 2000 war das zweite Tausend sozusagen »voll«. Denn das erste Jahr der christlichen Zeitrechnung war das Jahr eins nach Christus, in der Zählung direkt davor liegt das letzte Jahr des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, 1 vor Christus.
Endgültig durchsetzen konnte sich die Inkarnationsrechnung, also die Zählung ab der Fleischwerdung Jesu, übrigens erst zur Zeit der Aufklärung. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sich zu diesem Zeitpunkt erstmals ein Denken jenseits der universell christlichen Weltanschauung entwickelte. Doch die Rechnung ab einem fixen Punkt hat eben gerade für rationale Gemüter einige Berechtigung. Die Französische Revolution versuchte Ende des 18. Jahrhunderts zwar, mit einem ganz neuen Kalender auch einen neuen »Null-punkt« einzuführen: die Ausrufung der Republik am 22. September 1792, zufälligerweise eine Tag-und-Nacht-Gleiche. Diese Zeitrechnung galt aber nur zwölf Jahre, bis Napoleon sie zum 1. Januar 1806 wieder außer Kraft setzte. Während sich andere Errungenschaften dieser Zeit durchsetzten, kehrte man also zumindest kalendarisch bald wieder uneingeschränkt zum Christentum zurück.
Die Schlacht im Teutoburger Wald.
Kein Ort - kein Held?
Als die Römer seit der Regierungszeit Caesars versuchten, über Germanien eine gewisse, die eigenen Grenzen sichernde Kontrolle auszuüben, kam es zu einem Aufstand verschiedener germanischer Völker, der in der Niederlage der Römer in der berühmten »Schlacht im Teutoburger Wald« 9 nach Christus gipfelte. »Als die Römer frech geworden ...« dichtete im 19. Jahrhundert der Schriftsteller Joseph Victor von Scheffel in einem munteren Studentenlied. Man nennt die Schlacht auch Varusschlacht, nach dem römischen Feldherrn, der sich wegen der Schmach das Leben nahm. In seinen Annalen berichtet der römische Geschichtsschreiber Tacitus, die Germanen hätten die Römer unter einem Vorwand in einen Hinterhalt im Teutoburger Wald gelockt und so die empfindliche Niederlage herbeigeführt. Führer der Germanen war Arminius (oder Hermann), und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dem »deutschen Helden«, der dem germanischen Volk der Cherusker entstammte, auf der Grotenburg bei Detmold ein stattliches Nationaldenkmal errichtet. Scheffels Lied macht sich übrigens darüber lustig, dass es fast zwanzig Jahre dauerte, bis man mit dem Bau des Monuments beginnen konnte, denn die erhofften Spenden für das Nationaldenkmal blieben aus. Das 1100 kg schwere Pferd des Germanen spendete schließlich die Krupp-Stahl AG.
Hermann war ein idealer Nationalheld: Mutig und gewitzt, hatte er immerhin die mächtigen Römer geschlagen, und sogar deren Geschichtsschreiber kamen nicht umhin, dem »Barbaren« und »Befreier Germaniens« einen gewissen Respekt zu zollen.

1838 realisierte Ernst von Bandel die schon lange vorgesehenen Pläne, ein Arminiusdenkmal zu errichten. Heute drängen sich alljährlich über zwei Millionen Besucher um das Hermannsdenkmal.
Wie gemacht war der Held, um ein keimendes Nationalgefühl der Renaissance zu befördern, um Symbol zu sein für den Kampf der Reformation gegen die römische Kirche, um im Zuge der deutschen Einigung im 19. Jahrhundert als Sinn stiftende Figur verwendet oder im 20. Jahrhundert für eine Überhöhung vermeintlicher »germanischer Bestimmung« missbraucht zu werden. Dabei ließ man naturgemäß gerne außer Acht, was nicht so recht ins Idealbild zu passen schien: Zum Beispiel, dass der Cherusker Hermann die meisten seiner folgenden Schlachten verlor - wohl auch, weil er es künftig mit fähigeren Kriegsherren als dem unglücklichen Varus zu tun hatte. Oder dass er eigentlich ein Verräter war, mochten es auch die Römer gewesen sein, die er betrog. Immerhin war er in Rom erzogen und sogar geadelt worden, hatte in der römischen Armee gedient und besaß das römische Bürgerrecht. Ebenso gerne wurde übersehen, dass er mit der gewonnenen Schlacht den Zenit seiner Karriere bereits überschritten hatte, denn selbst wenn er die Germanen von der römischen Fremdherrschaft befreit haben mochte, so war er doch nicht in der Lage, die rivalisierenden germanischen Stämme zu einigen. Tacitus machte dafür seine persönliche Machtgier verantwortlich. Noch dazu wurde Hermann später ermordet; der Täter stammte aus dem engsten Familienkreis. Immerhin war dem Sieg über die Römer Dauer beschieden, denn Kaiser Augustus verzichtete darauf, die peinliche Schlappe wieder wettzumachen und überließ die Germanen sich selbst.
So ist Hermann also in Wirklichkeit gar nicht der strahlende, unanfechtbare, integere Held gewesen, sondern wurde später einfach dazu gemacht. Aber nicht nur das Heldentum des germanischen Kämpfers ist weitgehend erfunden, auch der Name der Schlacht ist schlichtweg falsch. Denn im Teutoburger Wald, wo sich das Hermannsdenkmal noch heute stolz erhebt, hat die Schlacht höchstwahrscheinlich nie stattgefunden. Schon die Angaben der zeitgenössischen römischen His-toriografen widersprechen sich in der Bezeichnung des Ortes. So verlässlich Tacitus im Allgemeinen auch sein mag - germanische Ortskunde war offenbar nicht seine Stärke. Archäologen haben viel Zeit und Mühe darauf verwandt, die Stätte der großen Schlacht zu identifizieren, und vieles spricht dafür, dass die »Schlacht im Teutoburger Wald« mehr als 100 km vom Denkmal entfernt in der Kalkrieser Senke nördlich von Osnabrück geschlagen wurde. Daher ist die Bezeichnung »Varusschlacht« weniger irreführend und weitaus zutreffender. Unter Historikern hat sie sich inzwischen durchgesetzt. Denn der Name »Schlacht in der Kalkrieser Senke« klingt nicht besonders gut, und hundertprozentig sicher darf man sich mit dieser Ortsangabe zum anderen nicht sein. Also gehen die Fachleute lieber auf Nummer Sicher: Dass Varus die römischen Truppen befehligte, steht definitiv außer Frage.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Irrtümer und Legenden der deutschen Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.