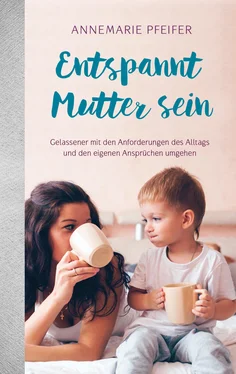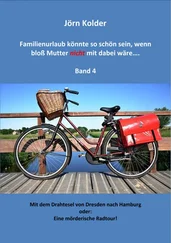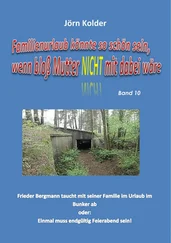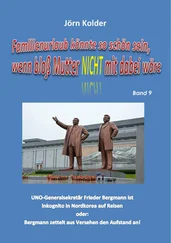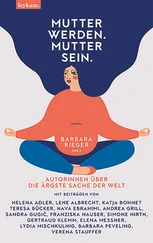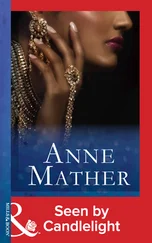Glücklicherweise sind wir jedoch diesen vielen Anforderungen nicht hilflos ausgeliefert. Wir können den Druck auf uns reduzieren, indem wir unsere Ideale kritisch hinterfragen und unrealistische Erwartungen über Bord werfen.
Fünf überhöhte Ideale
Viele Vorstellungen von Schwangerschaft und Mutterschaft werden von Generation zu Generation überliefert und haben manchmal beinahe magischen Charakter. Und nicht selten erwartet man unterschwellig, dass man durch die Tatsache der Mutterschaft von einer normalen, durchschnittlichen Frau über Nacht zu einem beinahe überirdischen Wesen wird, welches seine eigenen Emotionen zu jeder Zeit kontrollieren kann und alle seine eigenen Träume und Wünsche den Erwartungen des Kindes unterordnet. Mit dem Wachstum des Bauches, den Veränderungen im Hormonhaushalt, dem Erlebnis der Geburt und dem Stillen des Säuglings sollen sich ganz neue Fähigkeiten und Charakterzüge entfalten. Die unternehmungslustige, lebensfrohe und lebhafte Frau soll sich über Nacht in das Idealbild der ruhigen, hingebungsvollen und allwissenden Mutter verwandeln. Gleichzeitig soll die Mutter weiterhin eine attraktive und interessante Partnerin sein, die Karriere macht und ihre eigenen Wünsche erfüllt. Was für ein hohes Ziel!
Ideal Nr. 1:
Gute Mütter befriedigen die Bedürfnisse ihrer Kinder
In der Tat kennt eine Mutter ihr Kind am besten. Sie hat es rund um die Uhr versorgt, ist zu allen Nachtstunden aufgestanden und hat freudig die kleinsten Entwicklungsschritte begrüßt. Sie kennt seine Gelüste und Abneigungen, seine Essgewohnheiten und Krankheiten. Eine Mutter hat tatsächlich oftmals einen sechsten Sinn. Ein Blick in die vordergründig unschuldigen Augen ihres Kindes genügt ihr, und sie weiß, wer die Scheibe im Nachbarhaus zerschlagen oder wer die Schokoladenkekse stibitzt hat. Und schon am Zuknallen der Tür erkennt sie den Seelenzustand der heimkehrenden Tochter.
Doch erahnen gute Mütter tatsächlich immer intuitiv, was ihr Kind braucht, so wie es ein Psychoanalytiker während eines Kongresses forderte?
„Ein kleines Kind verfügt nicht über die Worte, mit denen es sich mitteilen könnte. Es kann nur dadurch kommunizieren, dass es eine bestimmte emotionale Reaktion herbeiführt. Wenn dieser Affekt von der Mutter aufgegriffen und verstanden wird, kann sie das, was das Kind ihrer Meinung nach erlebt, in Worte fassen … Ist die Mutter eine Frau, die ihren emotionalen Hunger, ihre Ambivalenz, ihren Hass oder irgendeinen anderen Aspekt ihrer selbst nicht akzeptiert, wird sie nicht einfühlsam auf die Botschaften des Kindes reagieren, und das Kind wird sich missverstanden und alleingelassen fühlen.“ 5
Kinder brauchen also nach Meinung dieser Fachleute das absolute Verständnis durch ihre Mutter, welche mit sich und der Welt vollkommen im Reinen ist. Wer ist das schon? Wer hat nicht manchmal dunkle Stunden, in denen man das schreiende Baby am liebsten abgeben würde? Doch wenn eine Mutter nicht dauernd ein positives Gefühl zum Kind aufrechterhalten kann, muss sie laut diesem Psychologen fürchten, dass ihr Kind Schaden nehmen könnte. Sie sollte in der kindlichen Seele lesen wie in einem offenen Buch und wissen, was es nötig hat – denn gute Mütter kennen ihre Kinder durch und durch.
Ideal Nr. 2:
Gute Mütter leben nur für ihre Kinder
Kinder brauchen ihre Mutter, daran zweifelt wohl niemand. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr benötigen sie Fürsorge und Aufmerksamkeit, besonders, wenn sie klein sind. Doch sind Mütter das Schicksal ihrer Kinder, wie das die Lehren der Tiefenpsychologie behaupten?
„Wir fangen eben erst an zu verstehen, wie absolut nötig die Mutterliebe für das Neugeborene ist. Die körperliche Gesundheit des Erwachsenen wird in der Kindheit begründet, aber die seelische Gesundheit des Menschen bewirkt die Mutter in den ersten Wochen und Monaten des Lebens … Das Vergnügen, das man bei dem unsauberen Geschäft der Säuglingspflege empfinden kann, ist auch für das Kind von lebenswichtiger Bedeutung.“ 6
So etwas konnte wohl nur ein Mann schreiben, der noch nie ein Baby gewickelt hat! Welche Mutter (oder welcher Vater) hat in den ersten anstrengenden Wochen nach der Geburt immer voller Freude diese „unsauberen Geschäfte“ erledigt? Hat ihr Kind nun deshalb Schaden gelitten?
David Winnicott, ein angesehener Psychologe, schrieb die oben zitierten Worte in einer wissenschaftlichen Abhandlung in den 1970er Jahren. Sie stehen stellvertretend für das Dilemma, das die damals neuen Lehren der Tiefenpsychologie auslösten und das bis heute seine Wirkung entfaltet: Die Mutterliebe wird als prägende Erfahrung für ein Kind beschrieben – das ist gut so. Doch diese richtige Feststellung kann übersteigert werden und Mütter auch heute noch stark verunsichern. Anscheinend wird Mama zur Gefahr für das Kind, falls sie sich ihm zu wenig zuwendet oder auch mal negative Gefühle ihm gegenüber entwickelt. Diese unterschwellige Drohung treibt viele Mütter zu Höchstleistungen. Sie gönnen sich kaum eine Verschnaufpause und sind allzeit abrufbereit. Das Kind wird beispielsweise jahrelang im Ehebett einquartiert, damit es ja keine Verlassenheitsgefühle entwickelt. Selbstverständlich hat sich die Mutter damit abzufinden, dass sie über Jahre an Schlafentzug leidet und das Paar dadurch auf intimes Zusammensein verzichten muss.
Darf eine Mutter neben ihrem Kleinkind noch anderen Interessen nachgehen? Wohl kaum – denn das Kind könnte dadurch Schaden nehmen.
Ideal Nr. 3:
Gute Mütter haben erfolgreiche und gesunde Kinder
„Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir.“ Das wünschen sich die meisten Eltern. Doch leise schwingt oft auch die Vorstellung mit, dass die Kinder es einmal besser machen sollen. Heute stellt man sehr hohe Anforderungen an das Wunschkind. Schon im Mutterleib untersucht man durch pränatale Diagnostik, ob das werdende Wesen gesund ist. Besteht auch nur der Verdacht einer Behinderung, steht es der Schwangeren frei, das Kind „wegmachen“ zu lassen. Eltern, die ihr behindertes Kind annehmen möchten, stehen zunehmend unter Druck, weil sie der Gesellschaft unnötige Kosten aufbürden. Gute Mütter haben gesunde Kinder.
Darf dann das Kind tatsächlich das Licht der Welt erblicken, beginnt das große Erziehungswerk der Eltern. Schon Kleinkinder sollen fachgerecht und ausgiebig gefördert werden. Und man glaubt es kaum, aber das beginnt bereits mit der Frage, ob ein Kind Windeln tragen soll oder nicht. Ein neuerer Trend bürdet den Müttern auf, immer zu wissen, wann das Kleine mal muss, denn Windeln könnten es einengen. Deshalb wird auf Windeln verzichtet, und man wäscht dem Kind zuliebe die Bettwäsche, den Teppich oder das eigene T-Shirt, wenn – wie zu erwarten ist – das kleine „Geschäft“ danebengeht. Meist ist es eine Frage der Zeit, bis frau zu den Windeln wechselt. Nur leider muss sie deshalb in der Kunst der Erziehung bereits eine erste Niederlage verkraften.
Später werden dann gute Schulleistungen als Tor zu einem erfolgreichen Leben gesehen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat in einer groß angelegten Studie die Lebenssituation der Eltern untersucht. In einer Zusammenfassung schreibt Christine Henry-Huthmacher 7dazu: „Der Druck, schon beim Kleinkind nur keine Chance auszulassen, da sie sonst ihrer heutigen Elternpflicht, das Kind optimal zu fördern, nicht gerecht werden, scheint allgegenwärtig. Dieser Bildungsdruck setzt sich im Grundschulalter fort: Eltern unternehmen enorme Anstrengungen und investieren viel Geld in private Anbieter, damit ihr Kind gute Noten erhält … Damit die Kinder den Anforderungen der Schule gerecht werden können, helfen fast 40 Prozent der Eltern häufig bis regelmäßig bei den täglichen Hausaufgaben.“ Nicht selten übernehmen vor allem die Mütter diesen Job – und damit wird der Erfolg ihrer Kinder zu ihrem eigenen Erfolg.
Читать дальше