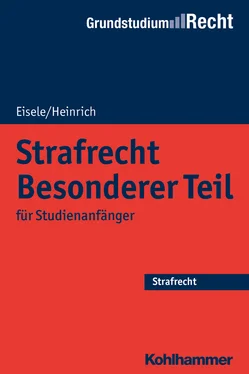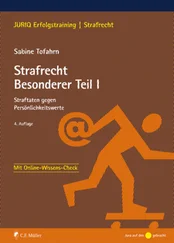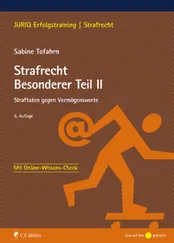140Der BGH begründet in solchen Fällen eine entsprechende Strafbarkeit damit, dass ab dem Zeitpunkt der Bewusstlosigkeit die Tatherrschaft bei T liege 281. Die Garantenstellung wurde zunächst aus dem pflichtwidrigen Vorverhalten abgeleitet 282. Hiergegen spricht aber, dass entsprechend den Grundsätzen beim Fahrlässigkeitsdelikt ein Pflichtwidrigkeitszusammenhang zwischen dem Vorverhalten und dem Erfolg bestehen muss. Scheidet bezüglich des Vorverhaltens eine fahrlässige Tötung aus, weil die Tat nicht objektiv zurechenbar ist, so kann das nachfolgende Verhalten insoweit nicht als (vorsätzliche) Unterlassungstat bestraft werden 283. Im Beispielsfall knüpft der BGH nicht (mehr) an ein pflichtwidriges Vorverhalten an, sondern bejaht eine Überwachungsgarantenstellung kraft Sachherrschaft über den gefährlichen Gegenstand 284. Die Straflosigkeit des Vorverhaltens soll nichts daran ändern, dass ab dem Eintritt einer konkreten Gefahrenlage für das Opfer eine Garantenpflicht entstehe. Denn anders als in Selbsttötungsfällen erschöpfe sich bei der Selbstgefährdung die Preisgabe des Rechtsguts in der Risikoaussetzung; eine Hinnahme des als möglich erkannten Erfolgseintritts sei damit nicht notwendig verbunden 285. Dies überzeugt jedoch nicht. Führt man die Argumentation des BGH konsequent zu Ende, so müsste auch die eigenverantwortliche Selbstgefährdung, jedenfalls aber die Einwilligung in eine Fremdgefährdung die Strafbarkeit nicht entfallen lassen. Denn auch hier bezieht sich aus Sicht des BGH das Handeln des Opfers nur auf die Gefährdung, nicht aber die Billigung des Erfolges 286.
141 a) Rechtfertigung kraft Einwilligung.Diese kommt nach h. M. bei einer einverständlichen Fremdgefährdung– die Tatherrschaft liegt anders als bei der Selbstgefährdung hier beim Beteiligten – in Betracht. Für die Rechtfertigung soll es demnach ausreichend sein, dass das Opfer bereits in die lebensgefährdende Handlung (und nicht in die Tötung) einwilligt und damit das Handlungsunrecht entfällt 287. Auf die (zufällige) Realisierung des Erfolges kommt es daher nicht an. Anders als bei der vorsätzlichen Tötung steht daher die mangelnde Dispositionsbefugnis über das Leben der Einwilligung nicht entgegen. Die Gegenansicht lässt hingegen eine solche Risikoeinwilligung nicht zu, da auch das Fahrlässigkeitsdelikt maßgeblich vom Erfolgsunrecht geprägt sei 288.
Bsp. 1:T nimmt mit seinem Wagen an einer Wettfahrt teil; O nimmt freiwillig als Beifahrer teil, obwohl O die Gefährlichkeit dieser Fahrt kennt. Der Wagen kommt dabei in Folge eines leichten Fahrfehlers von der Straße ab, prallt gegen einen Baum, wodurch O zu Tode kommt. – T macht sich nicht nach § 222 strafbar; zwar liegt der Tatbestand einer fahrlässigen Tötung vor, weil T als Fahrer die Tatherrschaft über das Geschehen besaß und damit eine Fremdgefährdung vorlag 289; jedoch hatte O in die Gefährdung eingewilligt, so dass die Tat nach h. M. nicht rechtswidrig ist.
Bsp. 2: 290Wie Bsp. 1, jedoch überholt T plötzlich hochriskant, so dass sich auf einer zweispurigen Straße drei Fahrzeuge im Abstand von jeweils 30 cm nebeneinander befinden; als der Wagen des T den Grünstreifen berüht, kommt er von der Fahrbahn ab und prallt mit tödlichen Folgen für O gegen einen Baum. – Eine Einwilligung ist hier zu verneinen, weil sich diese nicht auf den gefährlichen Überholvorgang bezog 291; soweit der BGH im Beispielsfall allerdings unter Berufung auf den Normzweck des § 228 und die gesetzgeberische Wertung des § 216 davon ausgeht, dass eine wirksame Einwilligung bei konkreter Todesgefahr ausscheidet 292, ist dies wenig überzeugend, da mit dem Eintritt des Todes bei § 222 eine solche Gefahr regelmäßig verbunden sein wird und andernfalls kaum mehr Raum für eine Einwilligung bliebe. Zudem muss man sehen, dass § 216 nur Vorsatztaten betrifft und selbst die Vorschrift des § 228 systematisch im Bereich der Körperverletzungsdelikte verankert ist; im Ergebnis würde man ansonsten aus überindividuellen Interessen zur Schaffung eines Lebensgefährdungsdelikts gelangen, was im Hinblick auf Art. 103 Abs. 2 GG nicht unproblematisch wäre 293. Soweit der BGH im Rahmen der Grenze des § 228 294auch darauf abstellt, dass eine wirksame Einwilligung bei konkreter Todesgefahr ausscheidet 295, bleibt dies vage, da mit dem Eintritt des Todes eine solche Gefahr ja regelmäßig verbunden sein wird. Entscheidend kann nur sein, ob sich bei Erteilung der Einwilligung eine solche konkret gefährliche Lebensgefahr prognostizieren lässt.
142Jedoch ist die Einwilligung nicht schrankenlos, da selbst bei der fahrlässigen Körperverletzung die Grenzen des § 228zu beachten sind. Die hierfür entwickelten Grundsätze sollten daher auch für die fahrlässige Tötung gelten: Je größer die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Ausgangs ist und umso weniger gewichtig der verfolgte Zweck ist, desto eher ist von Sittenwidrigkeit der Tat auszugehen 296. Nach anderer Ansicht soll hingegen die Fremdgefährdung der Selbstgefährdung gleichzustellen und bereits auf Tatbestandsebene im Rahmen der objektiven Zurechnung zu behandeln sein 297. Die Einwilligung ist demnach solange wirksam, wie dem Gefährdeten das Risiko in demselben Maße bewusst ist wie dem Gefährdenden und der Schaden Folge des spezifisch eingegangenen Risikos ist.
Bsp.:T ist auf Grund erheblichen Alkoholkonsums fahruntüchtig; dennoch wird er von O, der Kenntnis vom Umfang des Alkoholgenusses besitzt, gebeten, ihn mit nach Hause zu nehmen. Auf Grund eines alkoholbedingten Fahrfehlers kommt es zu einem Verkehrsunfall, bei dem O getötet wird. – Man kann hier vertreten, dass die fahrlässige Tötung durch die Einwilligung des O gerechtfertigt ist, wenn man der Auffassung ist, dass die Tat angesichts des ursprünglich nur abstrakten Risikos eines Unfalles nicht gegen die guten Sitten verstößt. Zu einem entsprechenden Ergebnis gelangt man auch mit der Gegenansicht, weil sich O des Risikos im selben Maße wie T bewusst war und sich die spezifische Gefahr einer Trunkenheitsfahrt im Erfolg realisiert hat.
143 b) Rechtfertigung gem. § 34.Diese ist richtigerweise auch bei einer fahrlässigen Tötung möglich, da es in solchen Situationen ebenfalls nur um die Rechtfertigung einer riskanten Handlung geht.
Einführende Aufsätze:
Eisele, Freiverantwortliches Opferverhalten und Selbstgefährdung, JuS 2012, 577; Mitsch , Grundfälle zu den Tötungsdelikten, JuS 1996, 407 (Allgemeines zur fahrlässigen Tötung mit Beispielfall).
Übungsfälle:
Eisele , Das Bremsmanöver, JA 2003, 40 (Ziehen einer Handbremse während der Fahrt, Rechtfertigungsgründe §§ 32, 34 StGB, Kausalität, objektive Zurechnung); Fahl , Nachts sind alle Katzen grau, Jura 2005, 273 (Tot durch Schock, Sorgfaltspflichtverletzung); Kreß/Mühlfarth , „Tödliches Liebesspiel“, JA 2011, 268 (Sittenwidrigkeit iSd § 228 StGB, einverständliche Selbstgefährdung, Risikoeinwilligung, Einwilligungssperre, Irrtümer, aufgedrängte Not(stands)hilfe).
Rechtsprechung:
BGHSt 24, 342– Selbstmord (fahrlässige Verursachung einer fremden Selbsttötung); BGHSt 39, 322– Brand-Retter (Selbstgefährdung des Retters); BGHSt 53, 55– Autorennen (Einwilligung in Fremdgefährdung); BGHSt 53, 288– „Falschlieferung“ (Selbstgefährdung des BtM-Konsumenten); OLG Stuttgart NJW 2008, 1971– Feuerwehr (Selbstgefährdung des Retters); OLG Stuttgart JR 2012, 163– Überholmanöver (mittelbare Drittgefährdung).
VI.Aussetzung, § 221
1.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
144Obwohl die Vorschrift des § 221 ihre systematische Stellung bei den Straftaten gegen das Leben hat, ist geschütztes Rechtsgut nicht nur das Leben, sondern ausweislich des Wortlauts „schwere Gesundheitsschädigung“ auch die körperliche Unversehrtheit. § 221 Abs. 1 enthält den Grundtatbestand. Es handelt sich hierbei um ein konkretes Gefährdungsdelikt 298. Nr. 1 enthält keine Beschränkung des Täterkreises, wohingegen Nr. 2 ein Sonderdelikt enthält. Die Worte „in seiner Obhut hat oder ihm sonst beizustehen verpflichtet ist“ bringen bei Nr. 2 zum Ausdruck, dass Täter des Delikts nur ein Garant i. S. d. § 13 sein kann 299. § 221 Abs. 2 Nr. 1 normiert einen echten Qualifikationstatbestand, während § 221 Abs. 2 Nr. 2 und § 221 Abs. 3 Erfolgsqualifikationen enthalten.
Читать дальше