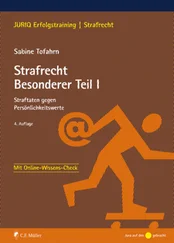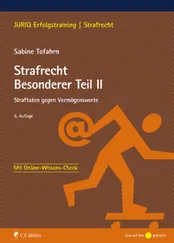Bsp.:T täuscht den O darüber, dass dieser unheilbar krank ist. O bittet daraufhin den T, ihn zu töten, um ihm weitere Leiden zu ersparen. – Da die Entscheidung des O irrtumsbehaftet ist, liegt kein ernstliches Tötungsverlangen vor, so dass § 212 zur Anwendung gelangt. Würde O selbst die lebensbeendende Handlung vornehmen, wären §§ 212, 25 Abs. 1 Var. 2 (und keine straflose Beteiligung an einer Selbsttötung) gegeben, weil T auf Grund seiner Täuschungshandlung die Tatherrschaft besaß und der nicht freiverantwortlich handelnde O damit ein sich selbst schädigendes Werkzeug wäre.
126 dd) Maßgeblicher Zeitpunkt.Erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass das ausdrückliche und ernstliche Verlangen im Tatzeitpunktnoch fortbesteht. Daraus folgt zugleich, dass das Tötungsverlangen jederzeit widerrufbar ist 253. Ferner sind Bedingungen und Beschränkungen im Hinblick auf die Tötungsart zu beachten. Dem Verlangen wird jedenfalls dann nicht mehr Rechnung getragen, wenn eine wesentliche Abweichung hinsichtlich der verlangten Tötungsart vorliegt 254.
127 c) Durch das Verlangen zur Tötung bestimmt.Der Täter muss gerade durch das Tötungsverlangen des Opfers zur Tötung bestimmt worden sein. Das Verlangen muss demgemäß handlungsleitend sein, was etwa zu verneinen ist, wenn der Täter bewusst ein Opfer sucht, das in die Tötung einwilligt 255. Bei sog. Motivbündelngenügt es, dass das Tötungsverlangen bewusstseinsdominant ist 256, so dass weitere untergeordnete Motive (z. B. Aussicht auf Erbschaft) der Anwendung des Privilegierungstatbestands nicht entgegenstehen.
128 aa) Bestimmen.Für die Konkretisierung kann auf die für die Anstiftung geltenden Grundsätze zurückgegriffen werden. Wer demnach bereits zur Tat entschlossen ist (omnimodo facturus), kann nicht mehr zur Tat bestimmt werden 257.
Bsp.:T beschließt, seine schwerkranke Ehefrau O zu töten, um ihr weitere Leiden zu ersparen. Kurz vor der Tat bittet die O ihn ausdrücklich und ernstlich darum, sie zu töten. – Es liegt kein Fall des § 216 vor, da T nicht durch das Verlangen der O zur Tat bestimmt wurde. Im Rahmen des § 212 kann dem geringeren Schweregehalt der Tat ggf. über die Strafzumessungsregel des § 213 Var. 2 Rechnung getragen werden. Soweit Mordmerkmale verwirklicht sind, müsste diskutiert werden, ob die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe schuldangemessen ist und diese ggf. im Wege der Tatbestands- oder Rechtsfolgenlösung vermieden werden kann 258.
129 bb) Anwendung von § 28 Abs. 2.Das privilegierende Merkmal des Tötungsverlangenswird von der h. M. zu Recht als ein besonderes persönliches Merkmal i. S. d. § 28 Abs. 2 eingestuft, weil die Privilegierung ihre Begründung auch in der persönlichen Konflikt- bzw. Mitleidssituation findet. Bei mehreren Beteiligten kommt die Privilegierung damit nur demjenigen zugute, der selbst durch das Verlangen zur Tat bestimmt wurde 259. Nach der Gegenansicht handelt es sich dagegen um ein tatbezogenes Merkmal 260, für welches bei Teilnahme die Regeln der limitierten Akzessorietät gelten.
Bsp.:O bittet den T, ihn zu töten. G besorgt das Gift in Kenntnis dieser Situation, da er als Alleinerbe eingesetzt ist. – T macht sich gem. § 216 strafbar. Nach h. M. kommt G die Privilegierung nicht zugute, da er nicht von O zur Tat bestimmt wurde; da er aus Habgier handelte, kann er nach h. L. über § 28 Abs. 2 sogar nach §§ 211, 212, 27 bestraft werden, weil er ein persönliches Mordmerkmal verwirklicht (nach der Rechtsprechung kommen nur §§ 212, 27 in Betracht, da es an einer Haupttat nach § 211 fehlt 261). Nach der Gegenansicht kann G hingegen auf Grund der akzessorischen Haftung nur nach §§ 216, 27 bestraft werden.
130 d) Notwendige Beteiligung.Das Opfer, von dem das Tötungsverlangen ausgeht, ist als notwendig Beteiligter auch dann straflos (keine Anstiftung), wenn die Tat fehlschlägt und für den Täter daher ein Versuch des § 216 gegeben ist.
1313.Subjektiver Tatbestand und Irrtumsregel des § 16 Abs. 2
Subjektiv muss der Vorsatz des Täters die Voraussetzungen des § 216 erfassen. Nimmt der Täter irrig die Voraussetzungen des § 216 an, ohne dass ein ausdrückliches und ernstliches Verlangen des Getöteten vorliegt, so greift die Vorschrift des § 16 Abs. 2 ein. Der Täter ist daher nicht nach dem objektiv verwirklichten § 212, sondern nach dem milderen § 216 strafbar. Da durch den Irrtum der Tötungsvorsatz unberührt bleibt, ist § 222 in solchen Fällen auch dann ausgeschlossen, wenn dem Täter hinsichtlich des Irrtums Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Bsp.:Der schwerkranke O bittet den T, ihn von seinem Leiden zu erlösen, was T dann auch tut. Die Erklärung des O war jedoch nicht freiverantwortlich, da O – was T nicht erkannte – auf Grund seiner Krankheit bereits die notwendige Einsichtsfähigkeit fehlte. – Objektiv liegt nicht § 216, sondern § 212 vor, weil kein ernstliches Tötungsverlangen gegeben ist. Da sich T jedoch Tatumstände vorstellte, die – wenn sie vorgelegen hätten – den Tatbestand des § 216 begründet hätten, kommt ihm über § 16 Abs. 2 dennoch die Privilegierung zugute.
Einführende Aufsätze:
Bechtel , Selbsttötung, Fremdtötung, Tötung auf Verlangen, JuS 2016, 882; Kühl , Beteiligung an Selbsttötung und verlangte Fremdtötung ,Jura 2010, 81; Steinhilber , Streifzug durch zentrale Rechtsfragen der „direkten Sterbehilfe“ (§ 216 StGB), JA 2010, 430 (Probleme des objektiven und subjektiven Tatbestands, Teilnahmeproblematik und die Reichweite der Sperrwirkung des § 216 I StGB).
Übungsfälle:
Kühl/Kneba , Zwei ungleiche Söhne, JA 2011, 426 (versuchte Tötung auf Verlangen und die Beihilfe dazu, Körperverletzungsdelikte); Schmitt-Leonardy , Von der Bahre bis zur Wiege, JA 2018, 187 (Tötung auf Verlangen, Abgrenzung straffreie Selbsttötung und strafbare Fremdtötung, das Vorliegen eines Motivbündels, Akzessorietätsdurchbrechung gem. § 28 StGB im Rahmen der Beihilfe zur Tötung auf Verlangen); Weißer , Tödliche Erlösung, JuS 2009, 135 (klassische Probleme aus dem Bereich der (auch versuchten) Beteiligung an Tötungsdelikten, insbesondere die Behandlung der verschiedenen Mordmerkmale i. R. der §§ 28, 29 StGB).
Rechtsprechung:
BGHSt 13, 162– Hammerteich (Tötung auf Verlangen durch Unterlassen); BGHSt 50, 80– Kannibalenfall (Törungsverlangen); BGH StV 2011, 284– Revolver (Ernstlichkeit des Tötungsverlangens).
V.Fahrlässige Tötung, § 222
1.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
132§ 222 ist der klassische Typ des Fahrlässigkeitsdelikts. Die klausurrelevanten Probleme gehören fast vollständig in den Allgemeinen Teil 262. Hinsichtlich der systematischen Stellung innerhalb der Tötungsdelikte und des geschützten Rechtsguts kann auf die Ausführungen bei § 212 verwiesen werden 263. Im Folgenden soll noch einmal auf einige zentrale Fragen hingewiesen werden.
133  Prüfungsschema
Prüfungsschema
1. Tatbestand
a) Handlung (Tun oder Unterlassen): Töten
b) Erfolg: Tod eines anderen Menschen
c) Kausalität
d) Sorgfaltspflichtverletzung
e) Objektive Zurechnung, insb.
aa) Pflichtwidrigkeitszusammenhang und Schutzzweck der Norm
bb) Objektive Vorhersehbarkeit des Erfolges
Читать дальше
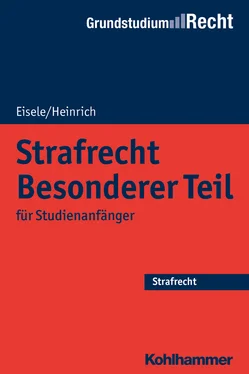
 Prüfungsschema
Prüfungsschema