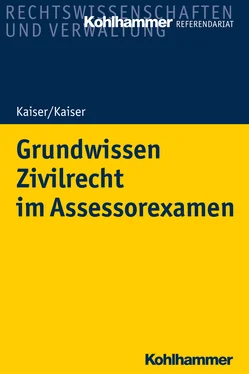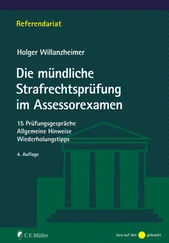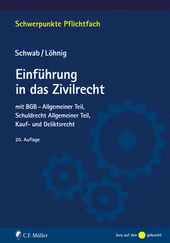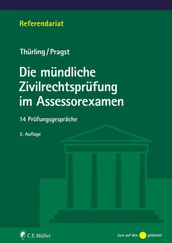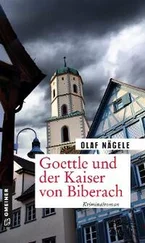1 ...6 7 8 10 11 12 ...27 32Auch die weitere Prüfung ist für Anwalt und Richter weitgehend vergleichbar. Der Anwalt wird für die Klage überlegen, an welches Gericht er die Klage schickt sowie wer Kläger und Beklagter ist und wie die Kriterien des § 253 ZPO eingehalten werden. Der Richter wird, wenn die Klage eingegangen ist, genauso diese Kriterien prüfen, insbesondere ob die Voraussetzungen des § 253 ZPO gewahrt sind. Gemeinsam ist beiden Klausurarten weiter, dass eine vernünftige und praktische Lösung gefordert wird.
33 b) Unterschiede zur Urteilsklausur.Der Hauptunterschied dieser Klausuren besteht darin, dass in der Rechtsanwaltsklausur meist ein Gutachten zur Rechtslage (ab und zu noch ein Mandantenschreiben oder ein Klageentwurf) erstellt werden muss, in der Richterklausur dagegen ein Urteil. In der Anwaltsklausur muss zudem stets mit dem Mandantenbegehren begonnen werden.
34Ein weiterer Unterschied der beiden Klausurarten liegt darin, dass in der Anwaltsklausur meist noch die Frage, wie zweckmäßigerweise weiter vorgegangen wird, beantwortet werden muss. So kann sich für den Anwalt die Frage stellen, ob es Sinn macht für seinen Mandanten Klage zu erheben oder nicht (Klägersicht) oder ob es Sinn macht Klageabweisung zu beantragen oder stattdessen den Anspruch anzuerkennen oder sich in die Säumnis zu flüchten (Beklagtensicht). Weiter kann sich die Frage stellen, ob auch ein Dritter in den Rechtsstreit einzubeziehen ist, beispielsweise durch Streitverkündung. Diese Zweckmäßigkeitserwägungen geben in der Anwaltsklausur selbstverständlich Punkte. Aber auch bei einer solchen gilt: Das Kernstück (nahezu) jeder Klausur ist die materiell-rechtliche Lösung.
35Der Begriff der Relationstechnik beschreibt lediglich die richterliche (anwaltliche) Arbeitstechnik, wie im Zivilprozess die Entscheidung gefunden wird. Sie geschieht in fünf Schritten:
(1) Ordnung des Prozessstoffes
(2) Prüfung der Zulässigkeit(diese hat das Gericht von Amts wegen zu prüfen)
(3) Klägerstation
In dieser wird geprüft, ob die Klage schlüssig ist, § 331 Abs. 1 S. 1 ZPO. Der Kläger hat dazu Tatsachen vorzutragen, die das geltend gemachte Recht stützen. Hier wird nur geprüft, ob der Vortrag des Klägers den geltend gemachten Anspruch ergibt. So hat bei der Kaufpreisklage der Kläger vorzutragen, dass er mit dem Beklagten einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen hat und der Kaufpreis fällig ist.
(4) Beklagtenstation
Sie ist das Gegenstück zur Klägerstation. Hier wird geprüft, ob die Einwendungen des Beklagten erheblich sind. Dies sind sie, wenn die behaupteten Einwendungen den Anspruch des Klägers zu Fall bringen. Bei der Kaufpreisklage wären etwa die Behauptungen des Beklagten, er habe den Kaufpreis bereits bezahlt oder er habe den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung durch den Kläger angefochten, erheblich.
(5) Beweisstation
Ist der Klagevortrag schlüssig und der Beklagtenvortrag erheblich, kommt es auf den Beweis an. Dabei ist zunächst zu klären, wer die Beweislast für welche Behauptung trägt. Anschließend ist zu prüfen, welcher Beweis angeboten ist und ob der Beweis erbracht werden kann.
Beispiel
Der Kläger K verlangt von Mieter M Herausgabe der Wohnung, §§ 546 Abs. 1, 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) BGB. Er trägt vor, der Beklagte (M) habe die letzten drei Monatsmieten (gesamt 3.000 Euro) nicht bezahlt, er habe M deshalb am 31.10.2018 zum 31.1.2019 gekündigt. Die Kündigung sei dem Beklagten am 31.10. zugegangen, dies könne die Zeugin X bestätigen. Der Beklagte will nicht räumen, er behauptet, die Kündigung sei nicht zugegangen, im Übrigen habe er rechtzeitig am 15.12.2018 mit einem Gegenanspruch über 3.000 Euro aufgerechnet. Der Kläger bestreitet dies, da der Gegenanspruch nur über 500 Euro gegeben gewesen sei.
36 Anwendung der Relationstechnik.Die Räumungsklage ist schlüssig. Der Kläger hat vorgetragen, dass ein Mietvertrag zwischen den Parteien bestand, der von ihm gekündigt wurde. Ebenso hat er das Vorliegen einer Kündigung und eines Kündigungsgrundes vorgetragen.
Der Beklagtenvortrag ist insoweit erheblich, als er bestreitet, dass die Kündigung zugegangen ist und dass er rechtzeitig erfüllt habe.
Der Vortrag des Klägers ist wegen der Aufrechnung erheblich, da er behauptet, die Gegenforderung habe nur 500 Euro betragen.
Über die Frage des Zugangs der Kündigung ist Beweis zu erheben, da der Kläger dafür beweisbelastet ist und dafür auch Beweis angetreten hat. Über die Aufrechnung dürfte dagegen kein Beweis zu erheben sein. Der Beklagte hat die Forderung vorgetragen, der Kläger hat die Höhe bestritten. Der Beklagte ist für die Aufrechnung und die Höhe beweisbelastet, hat aber keinen Beweis angetreten. Selbst wenn die Aufrechnung in Höhe von 500 Euro erfolgreich wäre, wäre der Kündigungsgrund immer noch gegeben.
37Die Klage wird erhoben durch Zustellung eines Schriftsatzes, § 253 Abs. 1 ZPO, der zuvor bei Gericht eingereicht werden und den Anforderungen des § 253 ZPO genügen muss.
Der Kläger – meist vertreten durch einen Rechtsanwalt – hat sich bei den Vorüberlegungen und bei dem Abfassen der Klageschrift an dieser Norm auszurichten; er hat die Klageschrift nach den Anforderungen des § 253 ZPO zu fertigen. Der Richter prüft – von Amts wegen – ob die eingehende Klage den Voraussetzungen dieser Norm entspricht.
Auch in der Klausur sollten für die Prüfung der Zulässigkeit und der Begründetheit die Voraussetzungen des § 253 ZPO Ausgangspunkt sein; die Klausur sollte entsprechend aufgebaut werden.
I.Zuständigkeit und Bezeichnung des Gerichts, § 253 Abs. 2 Nr. 1 2. Alt. ZPO
1.Begriff der Zuständigkeit
38Der Rechtsanwalt hat als Erstes zu prüfen, an welches Gericht er die Klage zu richten hat – d. h. welches Gericht zuständig ist. Der Richter wird als erstes prüfen, ob er zuständig ist.
39 a) Arten der Zuständigkeit. – aa) Sachliche Zuständigkeit.Die sachliche Zuständigkeit bestimmt, welches von mehreren möglichen Eingangsgerichten (Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht) zur Entscheidung berufen ist. § 1 ZPO verweist dabei auf die Vorschriften des GVG; in den §§ 2 ff. ZPO ist bestimmt, wie der Gegenstandswert zu bemessen ist, wenn es auf den Streitwert ankommt. Ist das Gericht sachlich unzuständig, kann sich der Beklagte rügelos einlassen, § 39 ZPO, dadurch wird das zunächst unzuständige Gericht zuständig. Lässt sich der Beklagte nicht rügelos ein, kann der Kläger einen Antrag auf Verweisung an das zuständige Gericht stellen; erst wenn er dies nicht macht, wird die Klage als unzulässig abgewiesen.
40 bb) Örtliche Zuständigkeit.Die örtliche Zuständigkeit – das Gesetz spricht von Gerichtsstand – regelt, an welchem Ort das zuständige Eingangsgericht liegt. Viele Gerichtsstände sind in den §§ 12 ff. ZPO geregelt, aber auch sonst in der ZPO finden sich Zuständigkeitsregeln, etwa in § 771 Abs. 1 ZPO – Gericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattfindet; § 767 Abs. 2 ZPO – Gericht des ersten Rechtszuges. Außerhalb der ZPO regeln etwa die §§ 61, 75 GmbHG, § 246 Abs. 3 AktG die örtliche Zuständigkeit – Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. Die Folgen der Unzuständigkeit sind wie bei der sachlichen Zuständigkeit: Rügelose Einlassung, Antrag auf Verweisung, Abweisung der Klage.
41 cc) Funktionelle Zuständigkeit.Die funktionelle Zuständigkeit bestimmt, welches Rechtspflegeorgan diese konkrete Funktion ausübt, d. h. welches Justizorgan im konkreten Fall zuständig ist. So stellt sich häufig die Frage: Richter oder Rechtspfleger? Der Rechtspfleger ist etwa zuständig in Nachlasssachen, Mahnverfahren, Zwangsvollstreckungssachen, Kostenfestsetzung, vgl. §§ 3, 14 ff., 20 ff. RPflG. Die funktionelle Zuständigkeit betrifft auch die Fragen: Welches Instanzgericht ist zuständig? Beauftragter oder ersuchter Richter, §§ 361, 362 ZPO? Einzelrichter oder Kammer, §§ 348 ff. ZPO? Während bei der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit die Parteien meist noch ein Wahlrecht haben, zu welchem Gericht sie gehen, vgl. § 35 ZPO, ist die funktionelle Zuständigkeit stets ausschließlich. Die Parteien können nicht bestimmen, in welcher Instanz sie prozessieren wollen oder dass diesen Fall nicht der Richter, sondern der Rechtspfleger entscheiden soll. Ein Verstoß gegen die funktionelle Zuständigkeit hat unterschiedliche Folgen; in manchen Fällen ist der gesetzliche Richter nicht eingehalten; anders etwa § 8 RPflG, danach ist das Geschäft wirksam – und damit ist die funktionelle Unzuständigkeit folgenlos –, wenn der Richter statt des Rechtspflegers gehandelt hat.
Читать дальше