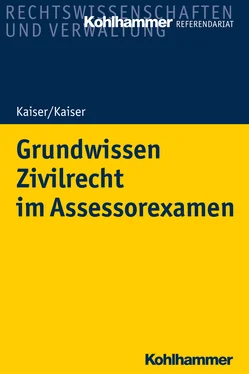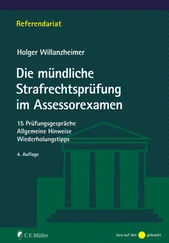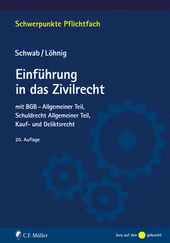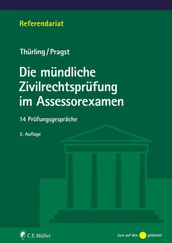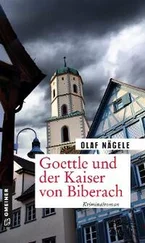20Kosten und vorläufige Vollstreckbarkeit gehören natürlich – wenn sie gefordert sind – auch zum Urteil. Sie sind für den Praktiker – der im zweiten Examen Korrektor ist – stets von Bedeutung, da sie in jedem Urteil zu bescheiden sind. Dementsprechend sind sie auch von großer Bedeutung in der Klausur.
21 c) Schrift und Darstellung.Nur was lesbar ist, kann bewertet werden. Die Schrift ist für viele Kandidaten ein Problem. Grundregel: Wer eine schlechte Schrift hat, sollte die Arbeit stark untergliedern, viele Absätze machen und reichlich Normen zitieren. Die Normen helfen wesentlich bei der Orientierung dessen, was man liest und damit beim Korrigieren. Bei einer sehr schlechten Schrift verliert der Korrektor sonst sehr schnell den Faden. Kommt eine Norm, wird er wieder eingefangen, denn nun weiß er wenigstens wieder, was der Kandidat gerade prüft. Viele Absätze lockern auf, eine starke Untergliederung – a), b), c) usw. für jede Voraussetzung – erleichtert das Lesen wesentlich; der Korrektor weiß nun zumindest, dass eine neue Voraussetzung geprüft wird.
22 d) Aufbau.Einer der wichtigsten Teile für die Bewertung der Arbeit ist der Aufbau. Er zeigt die gedankliche Klarheit des Schreibenden. Eine schöne Klausur ist ordentlich gegliedert, die Lösung ist aus dem Aufbau heraus verständlich. Der Aufbau zeigt oft mehr über die Gedankengänge des Verfassers als das Niedergeschriebene. Er zeigt deutlich, wie strukturiert die Arbeit ist, wie der Prüfling denkt und ob er den Fall und die Lösung erfasst hat. Absätze gehören dazu, dabei ist es am sinnvollsten, jedem neuen Gedanken einen Absatz zu geben, jeder Voraussetzung eine Ordnungsziffer. Auch die Entscheidungsgründe im Urteil gehören sauber durchgegliedert.
23 e) Zeiteinteilung.Wichtig für das Gelingen der Arbeit ist die Zeiteinteilung. Natürlich lassen sich hier keine sicheren Vorhersagen treffen. Wie viel Zeit für was benötigt wird, muss jeder Kandidat selbst – durch üben – herausfinden. Die letzten ca. 15 Minuten einer Klausur sollten allerdings für den Tenor reserviert werden. Der Tenor muss in dieser Zeit nicht nur gefertigt werden, zwingend erforderlich ist auch, dass überprüft wird, ob er mit den Ausführungen übereinstimmt. Daran fehlt es, wenn der Tenor zuerst gefertigt wird und der Verfasser während der Niederschrift seine Meinung und sein Ergebnis umstellt.
24 f) Ergebnis.Eine Klausur muss immer weitergehen. Es gibt daher nur sehr wenige Klausuren – zumindest bei Urteilen oder Beschlüssen – in denen die Klage unzulässig ist. Auch wenn eine Klage in einer Klausur zunächst unzulässig erscheint, ist diese bei genauerer Prüfung und Verwertung aller Hinweise in der Klausur doch meist zulässig. Sind Fristen versäumt, kann es beispielsweise die Wiedereinsetzung geben, wenn der Sachverhalt dazu Anhaltspunkte enthält. Ist die Klage – trotz allem – unzulässig, muss im Hilfsgutachten weiter geprüft werden. Dabei ist zu beachten, dass auch im Hilfsgutachten alle aufgeworfenen Fragen zu beantworten sind.
25Subjektiv schwierig kann eine Klausur auch dann sein, wenn sie dem jeweiligen Bearbeiter nicht liegt oder er die Probleme der Klausur nicht erkennt. Selbstverständlich ist es schwierig allgemeingültige Ratschläge für eine solche Klausur zu geben. Dennoch soll versucht werden, einige Hilfestellungen zu geben:
26 a) Anspruchsgrundlage nicht ersichtlich.Ist keine Anspruchsgrundlage ersichtlich, sollte im Zweifel auf § 812 BGB zurückgegriffen werden. Das Bereicherungsrecht ist auf nahezu jede Fallkonstellation anwendbar; jedenfalls ist es nicht abwegig einen Anspruch aus Bereicherungsrecht (an) zu prüfen (so kann beispielsweise ein Grundbuchberichtigungsanspruch auch über § 812 BGB gelöst werden). Bei der Frage des rechtlichen Grundes können meist alle Probleme geprüft werden, so können dabei sowohl Fragen eines Eigentumserwerbs als auch Fragen nach der Wirksamkeit eines Vertrages geprüft werden.
27 b) Untergliederung von Klausuren.Bei Unsicherheiten, wie eine Klausur begonnen werden soll, bietet es sich an, die Klausur zunächst zu untergliedern, sie in ihre Einzelteile zu zerlegen und die einzelnen Probleme – auf gesonderten Blättern, damit sie später je nach Bedarf zusammengesetzt werden können – einzeln zu bearbeiten. Es ist besser Probleme gesondert, als gar nicht behandelt zu haben. So wird zur Sicherung oder zur Verhinderung gutgläubigen Erwerbs häufig nach einer Vormerkung, einem Widerspruch, einem Rechtshängigkeitsvermerk, einem Veräußerungsverbot oder einem Erwerbsverbot gefragt. Wurden in einem solchen Fall die Einzelteile gelöst, kann sich daraus unter Umständen der gesamte Lösungsweg ergeben. Aber auch wenn dies nicht der Fall ist, ist es jedenfalls besser einzelne bearbeitete Teile abzugeben, als ein leeres Blatt.
28Bestehen Unsicherheiten nur insoweit, wie die Begründetheit der Klage zu bearbeiten ist, dann sollten zunächst Rubrum und Tatbestand, anschließend die Zulässigkeitsfragen bearbeitet werden; in diesen Bereichen ergeben sich meist keine Aufbauschwierigkeiten. Anschließend sollte die Klausur nochmals durchgelesen werden, wobei dabei die bereits (in Rubrum, Tatbestand und Zulässigkeit) abgehandelten Probleme gedanklich weggelassen werden können. Dadurch wird die Klausur (gedanklich) etwas übersichtlicher und die in der Begründetheit zu behandelnden Probleme weniger.
29 c) Verwertung der Parteiangaben.Allgemein kann gesagt werden, dass auf viele Probleme auch die Parteien selbst hinweisen. Wird eine Partei in einer mündlichen Verhandlung angehört und ist ihre Aussage im Protokoll abgedruckt, verbirgt sich stets ein Problem dahinter. Solche Aussagen müssen ggf. auch ausgelegt werden, eine Erklärung, sich etwas nicht gefallen lassen zu wollen, kann beispielsweise auf eine Anfechtung hindeuten. Im Protokoll kann eine Partei allerdings auch etwas unstreitig stellen so dass insoweit kein Beweis mehr zu erheben ist. Ein abgedrucktes Protokoll kann auch deshalb von Bedeutung sein, weil die Parteien darin ihre zuvor gestellten Anträge ändern oder ergänzen können. Sind in einer Klausur Zeitangaben vorhanden, stellen sich in der Regel Fristenprobleme (Rechtsmittelfrist, Einspruchsfrist oder Verjährung). Wird während dem Schreiben der Klausur bemerkt, dass die Zeit nicht reicht, sollte die Behandlung von Problemen kürzer ausfallen. Denn es ist besser, die Arbeit etwas oberflächlich aber ganz gelöst zu haben, als dass Anträge oder Problembereiche fehlen; nur der Stichwortzettel reicht zur Korrektur nicht.
30 d) Umstellung einer Klausur.Wird während des Schreibens der Klausur bemerkt, dass der (auf der Lösungsskizze vorhandene) Lösungsweg falsch ist, muss zwingend – bevor die gesamte Klausur umgestellt wird – die Frage gestellt werden, ob es zeitlich noch reicht, die gesamte Klausur umzustellen und eine sinnvolle Lösung zu Papier zu bringen. Denn auch hier gilt: Eine nicht fertige Klausur, die den richtigen Lösungsweg verfolgt, ist weniger wert, als eine Klausur, die zwar dem falschen Lösungsweg folgt, aber dennoch alle aufgeworfenen Fragen der Klausur bearbeitet und somit fertiggestellt ist.
31 a) Gemeinsamkeiten mit der Urteilsklausur.Der Unterschied zwischen der Urteils- und der Anwaltsklausur ist nicht so groß, wie es zunächst scheint; auch wenn darüber ganze Bücher geschrieben werden. Im Ergebnis stellen sich dieselben Probleme. Jede Urteilsklausur kann unproblematisch in eine Anwaltsklausur umgewandelt werden, indem vom Bearbeiter anstatt der Anfertigung eines Urteils verlangt wird, die Erfolgsaussichten der erhobenen Klage aus Anwaltssicht zu prüfen. Dies ergibt sich zudem daraus, dass sich die Arbeit des Anwalts nicht so wesentlich von der des Richters unterscheidet; beide wenden das Recht an. Der Anwalt im Vorfeld – er unterbreitet dem Richter seine Lösung als Klage –, der Richter nach Eingang der Klage, er prüft, ob die Klage den geltend gemachten Anspruch tatsächlich trägt. Die Klage lautet: „Mein Mandant hat einen Anspruch gegen den Beklagten auf Zahlung von 5.500 Euro aus § 433 Abs. 2 BGB, da er …“. Vergleichbar lautet das Urteil: „Der Kläger hat einen Anspruch gegen den Beklagten auf Zahlung von 5.500 Euro aus dem Kaufvertrag vom … nach § 433 Abs. 2 BGB“ oder „Die Klage wird abgewiesen“.
Читать дальше