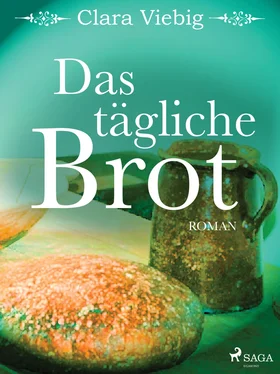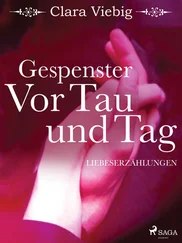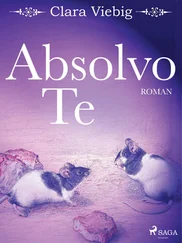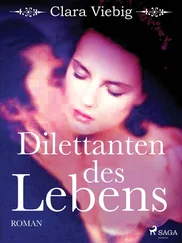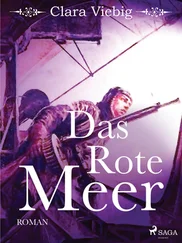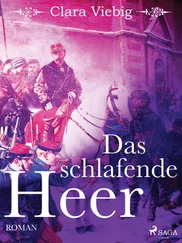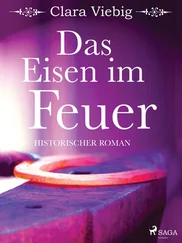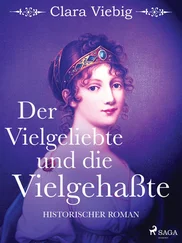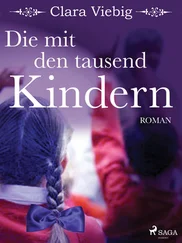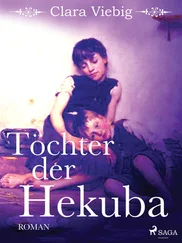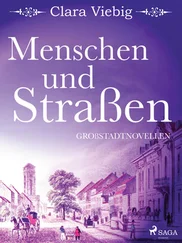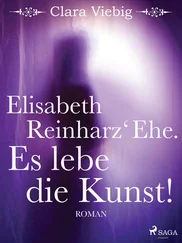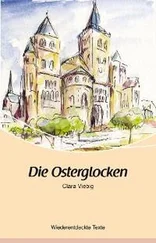Nun war es Winter, wenigstens dem Kalender nach, dem Wetter merkte man es nicht an. Kein Frost; Regen alle Tage. Der Reschkesche Keller glich einer dampfigen Höhle, in der man Gestalten auf- und niedertauchen sah wie höllische Wesen in einem brodelnden Hexenkessel.
Frau Reschke hatte abends nicht Sitzgelegenheiten genug für alle Besucher; auch Herren fanden sich ein, Bräutigame aus der Nachbarschaft, die ihre Bräute wenigstens einen trockenen Augenblick genießen wollten. Wenn Mutter Reschke besonders guter Laune war, öffnete sie einem wartenden Bräutigam ihr Privatzimmer und rief dem eiligst herbeistürmenden Mädchen wohlwollend zu: „Machen Se man, er is schon drinne! Da sind se janz unjestört!“
Nur Elli saß in der guten Stube. Aber die war ja noch ein Kind. Mine und Bertha trafen sich morgens oft im Keller. Frau Reschke hatte ihrer Nichte die Empfindlichkeit gegen Bertha ausgeredet. „Sei nich so tück’sch, Mine, eene Hand wäscht de andre. Un is se denn nich ein nettes Mächen?“
Das fand Mine auch und eine besondere Anhänglichkeit zog sie immer wieder zu jener hin; Bertha war ihr ein Stück Heimat, die ihr im Gewühl der Stadt, im Getriebe der Tage mehr und mehr zu entschwinden drohte. Die von daheim schrieben selten. Neulich hatte der Vater Malen einen Brief diktiert, da stand aber weiter nichts drin als: „Wir sind alle gesund“, und dann kam eine lange Litanei von Geschenken, die sie sich bei ihr zu Weihnachten bestellten. Kein Wort von dem, was Mine gerne hören wollte. Sie ärgerte sich, als sie langsam den Brief sinken ließ, den sie voller Freude hastig aufgerissen.
Sie beklagte sich bei Bertha. Diese lachte: „Sei nich so geizig!“
„Ne, ne, das is es nich bloß! Aber daß se so gar nich nach mer fragen!“
„Ä was! Schick ihnen was, un denn is ’s gutt. Ich hab Mutter ooch schon was geschickt; die is nu wie ’n Ohrwürmchen.“
Bertha hatte recht, sie stand mit ihrer Mutter jetzt auf sehr gutem Fuß, auf besserem, als es je zu Hause der Fall gewesen. Frau Fidler ging im ganzen Dorfe herum und zeigte das Tuch, das ihr die Tochter aus Berlin geschickt hatte; sie machte sich recht groß damit.
Bertha hatte das Tuch, ein seidenes, buntgestreiftes, bei Rosalie Grummach billig erstanden. Sie kaufte mit Vorliebe in dem düsteren Trödellädchen; da gab’s viel abgelegte Damengarderobe. Mit funkelnden Augen durchstöberte sie den ganzen Kram; Mutter und Tochter Grummach, zwei lichtscheue, großnasige Geschöpfe mit einem unendlichen Wust verfilzter krauser Haare, schleppten bereitwillig und anpreisend herbei. Bertha war eine gute Kundin; wenn ihr Sinn nach etwas stand, dann mußte sie’s auch haben. Sie ließ was draufgehn. Kein Wunder, daß die beiden Grummach’s, die wie Eulen aus dem Versteck der alten Kleider hervorlugten, auf sie losschossen, sowie sie vorüberging. Mit einem fröhlichen Gelächter probierte sie dieses und jenes an und drehte sich vor dem Spiegel, den ihr die Tochter diensteifrig vorhielt, während die Mutter sich in Schmeichelreden und Beteuerungen enormer Billigkeit erschöpfte. Der ganze Lohn ging manchmal drauf; mitunter schon etwas vom nächsten im voraus.
Bertha borgte sich öfter eine Kleinigkeit von Mine; die gab zwar mit einem gewissen Zögern, aber abzuschlagen wagte sie’s der Freundin doch nicht. Sie konnte sich nur nicht enthalten zu knurren: „Du hast doch siebzig Taler, fünfundzwanzig mehr wie ich — ich weiß nich, wo de’s läßt!“
„Ich ooch nich!“ Und Bertha lachte. Das Geld zerrann ihr unter den Fingern wie gar nichts. Daß sie sich ab und zu mal ein Törtchen kaufte, einen Berliner Pfannkuchen oder einen Windbeutel mit Schlagsahne, dafür konnte sie nichts, das mußte sie; das Essen bei Hauptmanns war nicht reichlich.
Beim Kaufmann drüben gab’s jetzt statt Seife eine Tafel Schokolade zu, die war jedesmal in einer Minute aufgeknabbert, und doch knurrte ihr der Magen. Siebzig Taler — damit war eben nicht auszukommen! Sie mußte mehr haben.
Frau Reschke riet ihr, nur noch das Weihnachtsgeschenk abzuwarten und dann am ersten Januar zu kündigen. „Passen Se man uff, zehn Dienste um eenen!“
Als der Termin näherrückte, war es Bertha doch nicht ganz wohl zumute. Sie versäumte jetzt nicht, sich jedesmal ganz außer Atem zu stellen, wenn sie die vier Treppen heraufkam; mochte die Gnädige denken, das viele Treppensteigen sei ihr zu schwer. Nun war der Weihnachtskarpfen im Haus. Das war eine Seltenheit, denn sonst gab es nur billigen Seefisch. Zitternd vor Aufregung umstanden die Kinder den Küchentisch. Ein Fisch, ein lebendiger Fisch! Da lag er, ein mächtiges Tier, dessen Schuppen goldig glänzten und das kräftig mit dem Schwanze schlug.
„Hat er Moos auf dem Kopf?“ fragte Kurt.
„Da hat er Moos“, sagte Bertha lachend und hieb dem Fisch mit der hölzernen Rührkeule eins auf den Kopf.
„Verstehen Sie denn auch damit umzugehen?“ fragte die Hauptmännin, einen Augenblick in die Küche guckend.
„Natürlich, gnäd’ge Frau!“ Bertha hatte keine Ahnung, aber so etwas gesteht man doch nicht ein. Sie machte sich daran, den Fisch zu schuppen; „lebendig schuppen“ hatte sie mal gehört, „dann geht’s besser“.
Der Karpfen lag ganz still, wie betäubt; das Messer blitzte, die Schuppen flogen — aber jetzt krümmte er sich zusammen wie im Krampf — jetzt schnellte er jäh in die Höhe. Hoch im Bogen sprang er vom Küchenbrett auf die Diele und glitt zappelnd dort umher.
Die Kinder schrien laut auf vor Schreck. Bertha packte ihn und warf ihn wieder aufs Brett; auch ihr war ängstlich zumute, aber sie unterdrückte das. Mit einem Lachen machte sie sich Mut. Nun rasch! Was? Einem noch die Schürze schmutzig machen?
Unruhig schlug der Fisch. Sie hieß den Knaben mit einem Tuch den glatten Schwanz festhalten. Sie wetzte das Messer scharf. Schuppe nach Schuppe. Die großen, seelenlosen Augen des Geschöpfes starrten, sein Maul tat sich auf — stumm, stumm! Blut floß, hell sickerte es unter den Schuppen vor. Den kleinen Kurt grauste es, er ließ den Schwanz fahren — da — ein Schrei der Kinder, ein Schrei Berthas — mitten ins Gesicht war der Fisch ihr geschnellt. Sie ließ das Messer fallen, ihr Lachen erstarb — au, das tat weh!
„Biest!“ Er glitschte ihr unter den Händen durch; nun rutschte er wieder auf die Diele, sie rutschte kreischend hinterher — hierhin, dorthin, da, dort — gradeaus, seitwärts — jetzt hatte sie ihn — jetzt war er unter dem Stuhl, unter dem Tisch. Die Kinder drängten sich auf einen Haufen, das kleinste fing an zu weinen.
„Willste wohl?!“ Die Schürze wurde ihr total schmutzig, jetzt achtete sie nicht mehr darauf. Ihre Hände griffen unruhig umher, eine Aufregung bemächtigte sich ihrer, eine sonderbare Gereiztheit, ein Zorn gegen das Vieh, das ihr so viel Wirtschaft machte. Eine Blutwelle stieg ihr heiß zu Kopf, ihre Lippen zuckten.
„Hab ich dich!“ Jetzt hatte sie ihn. Fest wie mit Eisenklammern packte sie ihn. Weit sperrte er das Maul auf — da — sah er nicht grimmig aus, schnappte er nicht nach ihrem Finger?
„Was, noch beißen?“ Ihre Zähne knirschten, ein Funkeln glomm in ihren Augen auf. „Dir wer ich lehren!“ Sie drückte den Zappelnden nieder, sie kniete auf ihm: „Biest! Biest!“ Zornig schrie sie, ihr Mund verzerrte sich.
Mit Gezeter stoben die Kinder aus der Küche. Als die Hauptmännin auf das Geschrei herbeieilte, fand sie Bertha mit hochrotem Kopf über den Fisch gebeugt, einen seltsamen Zug in dem noch lachenden Gesicht.
Das blutige Messer lag auf der Diele, mit beiden Händen riß sie dem in letzten Zuckungen sich bewegenden Tier das Eingeweide heraus. „Er wehrt sich noch — ha!“
„Diese Personen sind alle unglaublich roh“, sagte Frau von Saldern ganz entsetzt zu ihrem Mann.
Und doch, wer konnte sagen, daß Bertha roh war? Sie ließ sich gern rühren. Jede Woche kaufte sie für zwanzig Pfennige ein Heft vom Kolporteur, der die Hintertreppe heraufgeschlichen kam, mitunter auch zwei Hefte. Sie konnte gar nicht genug lesen von der betrogenen Unschuld armer Mädchen, von den reichen Verführern, von den geheimnisvollen Schandtaten der großen Stadt.
Читать дальше