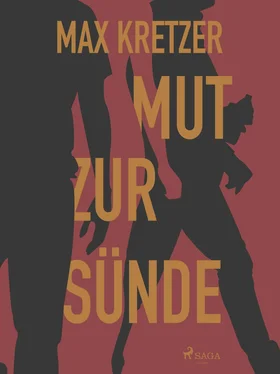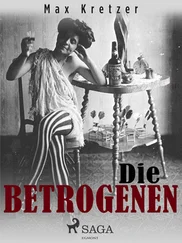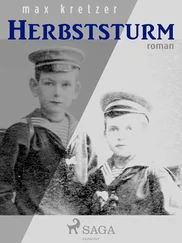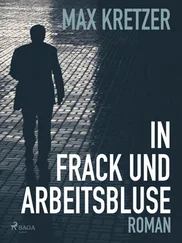Und als das alles jetzt in Ernestinens Seele wieder erwachte, war sie nahe daran, in die gleiche Stimmung zu verfallen; aber sie wollte sich heute nicht unterkriegen lassen, nicht von diesen jämmerlichen Gefühlen, die nach Entlastung schrieen. Weiter tragen diese Bürde, diese sich selbst auferlegte schwere Seelenlast, das sollte nach wie vor der Leitspruch ihres Daseins sein. Um ihres Sohnes willen!
Stark war, wer sich selbst bezwang.
Und Frau Frobel bezwang sich. Sie holte aus ihrer Kleidertasche den Brief Emmerichs hervor, in dem er sie mit pathetischen Worten an die alte, ewige Freundschaft erinnerte und sie bat, seiner „künstlerischen Wiedergeburt“ beizuwohnen, ging an den Majolikaofen in der Ecke, schraubte ihn auf, warf das zusammengeknickte Papier in die Asche und liess es durch ein brennendes Streichholz so lange in Flammen aufzüngeln, bis nichts mehr davon übrig geblieben war. Dann nahm sie die Feuerzange, vermengte noch die Asche und verschloss den Ofen mit derselben Sorgfalt. Und als sie sich dann wieder erhob und tief Atem holte, kam sie sich im Augenblicke nicht nur wie erleichtert vor, sondern auch wie gesäubert von etwas Unreinem, das sie wider Willen mit herumgetragen hatte.
Noch einmal hielt Frau Frobel Umschau im Zimmer auf ihrem Schreibtisch. Sie nahm die Zeitung, drehte die Arbeitslampe ab, ging bis zur Wohnungstür und schaltete die letzte Deckenflamme aus, was sie erst tat, als ihr schon das Licht aus dem anderen Zimmer entgegenflutete. Dann, verriegelte sie auch hier die Tür von innen und setzte zugleich den Knopf der elektrischen Klingel dreimal in Bewegung, was das Zeichen für ihre Ankunft war, wonach denn gewöhnlich alles rebellisch wurde.
Frau Doktor Rumpf, die Hausdame, wurde sichtbar, um noch rasch einige Anordnungen für die Abendtafel entgegenzunehmen. Sie war die alleinstehende Witwe eines vermögenslosen Arztes, eine angenehme, noch nicht alte Dame mit offenem, freundlichem Wesen, aber ohne jede Leidenschaft. Als Frau Frobel einsah, dass sie sich schwer vom Geschäft werde lossagen können, suchte sie nach einer gebildeten Stütze, und so kam sie auf die ihr so warm empfohlene „Frau Doktor“, wie man sie allgemein im Hause nannte, die besonders kinderlieb war und nun schon seit einem Jahrzehnt sich als das Muster einer klugen und treuen Helferin in Alltagsdingen bewährt hatte.
„Es ist heute ein bisschen spät, hoffentlich ist die Gesellschaft nicht unruhig geworden“, sagte sie und ging mit raschen Schritten voran durch den grossen, in Herrenzimmerstil ausgestatteten Durchgangsraum, der in den bis in den Garten hineingebauten Seitenflügel führte. Öde und still lagen die Prunkräume, durch deren offene Türen man hinten einen schwachen Lichtschimmer erblickte, der aus dem Musiksalon kam, wo der Bechsteinflügel etwas suchend bearbeitet wurde.
„Es ist Edda, die sich den Rigoletto vorgenommen hat“, sagte Frau Rumpf. „Herr Frobel erzählte nämlich vor seinem Fortgehen, dass nächstens ein alter Bekannter der Familie darin auftreten werde. Und da hat sie sich gleich darüber hergemacht.“
„Was mein Mann nicht alles anstellt“, sagte Ernestine ärgerlich.
„Herr Günther ist gleich weggeflitzt, ohne was genossen zu haben“, fuhr die andere fort. „Er hatte es wieder sehr eilig.“
„Ja, er hat mich darum gebeten“, sagte Frau Frobel wieder. „Ich glaube, die jungen Herren wollen da irgendwo einen Klub gründen, und da muss man die kleinen Unarten verzeihen.“ Schon seit einiger Zeit gebrauchte sie solche Ausreden, um Günthers spätes Ausbleiben zu entschuldigen.
Statt nach hinten zu gehen, nahm sie nunmehr den Weg nach dem Musiksalon, wobei sie den langen und breiten, ganz hell gehaltenen Korridor, der fast wie ein blendender Saal aussah, durchschritt. Überall sah man weiss lackierte Türen und dazwischen Spiegel in vergoldeten Rahmen, üder denen die Glasbirnen wie riesige Wassertropfen aus dem Metallgerank hervortraten. An grossen Gesellschaftsabenden wurden die Gäste hier von einem Meer des Lichts empfangen, das sich in dem lackierten Glanz wie Sonnenglitzer wiegte.
„Aber Kind, was quälst du dich denn hier ab, du wirst dich erkälten“, sagte Frau Frobel zu ihrer Tochter, zwar vorwurfsvoll, aber doch mit der ganzen Zärtlichkeil einer liebenden Mutter. Und sie nahm Edda das Opernbuch vor der Nase fort und klappte den Flügel sanft zu.
„Aber Ma’chen, ich erkälte mich doch nicht“, schmollte Edda mit ihrer dünnen Stimme, hing sich aber, durchaus nicht böse, sofort an den Hals der Mutter, soweit das bei ihrem zurückgebliebenen Wachstum möglich war, denn sie war klein und niedlich, fast wie eine Zehnjährige; und wenn nicht ihr ausgewachsener Kopf auf breiten, fast gar nicht hängenden Schultern gewesen wäre, so hätte man sie auch dafür halten können.
„Doch, doch, es ist ja hier nicht geheizt“, fuhr Frau Frobel fort und drückte einen Kuss auf das seidenweiche Blondhaar ihres Schmerzenskindes. „Obendrein hast du nur eine dünne Bluse an. Übe doch hinten, da hast du doch dein Klavier.“
„Sei nur nicht böse, Ma’chen, nein? Der Flügel klingt doch viel schöner, und da die Noten nun gerade hier lagen . . . Sieh mal, mir ist gar nicht kalt, fühl mal meine Hände.“
Ein starker Liebreiz sprach aus ihrem Wesen, etwas sein Kindliches, das sofort gefangennahm. Dazu redete ihr grosses Auge, das mitzulächeln schien, wenn die Pupille unter der hellen Wimper beweglich hin und her ging. Überhaupt lachte das ganze Gesicht, sobald die roten Lippen des breiten Mundes sich verzogen und die etwas auseinanderstehenden Zähne weiss hervorblinkten. Sie lachte zu viel und fast immer, wenn man mit ihr sprach, — das war ihr Fehler, aber doch einer, der sie kleidete. Entschieden trug sie die Züge ihres Vaters, was besonders am Profil erkennbar war. Nur den Schädel hatte sie von der Mutter, diesen wohlgeformten Schädel, der sich so prächtig und rund am Hinterkopf ausbaute, wie eine schön gezeichnete Plastik.
„Du irrst dich, deine Hände sind ganz kalt“, sagte Frau Frobel aufs neue zärtlich und rieb ihr die dünnen, weissen Finger. „Komm und wärme dich, du hast viel zu wenig Blut.“
„Kann ich was dafür, Ma’chen? Das sagst du immer. Und Gerhard, der Ekel, nennt mich schon die Blutlose, wenn er mir eins auswischen will.“
„Ja, ein Ekel ist er manchmal, aber nur, wenn er seine unliebenswürdige Laune hat“, beruhigte sie Frau Frobel.
„Aber die habe ich doch nie, liebe Mama“, mischte sich unerwartet Gerhard hinein, der alles vom Nebensalon mit angehört hatte und nun mit seinen Albernheiten zu ihnen hereintrat. Er war länger als sein Vater, glich ihm aber sonst wie ein Ei dem anderen, nur dass bei seinem Entstehen die Schablone etwas verrückt worden war, wodurch der Trottel in ihm sich mehr nach der Richtung ins Übermoderne ausgebildet hatte.
Die Kleine war so erschrocken, dass sie die Hand aufs Herz legte. Dann klagte sie ihn an: „Siehst du, Ma’chen, so schleicht er nun umher und erschreckt die Menschen. Schon vorhin hat er’s so mit mir gemacht.“
Gerhard nahm das gar nicht übel und zeigte nach wie vor seine grossen Hauer, die sich unter dem nach englischer Art gestutzten Schnurrbart etwas sehr afrikanisch ausnahmen. Dazu das infolge des letzten Kopfschmisses durchsichtig geschorene Kopfhaar, der schlecht geheilte Durchzieher auf der linken blauroten Wange, der drei Zoll hohe Stehklappkragen, der seinen Beruf als Röllchen verfehlt hatte, und der degenerierte Korpsstudent war fertig. Natürlich ging er auch schlapp und krumm, weil die ewige Sorge, wie dieses bisschen Dasein wohl zu ertragen sei, ihn niederdrückte; und natürlich suchte er etwas darin, auch in der Kleidung, gleich seinem Alten, den kleinen Lord herauszubeissen, allerdings mit einem bedenklichen Stich ins Gigerlhafte: durch auffallend punktierte Modeweste, durch Stoffjackett, schildpattartig gemustert, und dito Beinkleider, selbstverständlich aufgekrempelt, so dass das schmale, schwarz bestrumpfte Fussgelenk über dem Lackschuh zu sehen war. Beinkleider natürlich mit Bügelfalte, Jackett auf Taille gearbeitet, Weste mit zweireihigen blanken Knöpfen stark in Bedientenmanier, — der ganze Kerl tipp-topp, herausgeschnitten aus dem neuesten Mode-Katalog seines teuersten aller Schneider.
Читать дальше