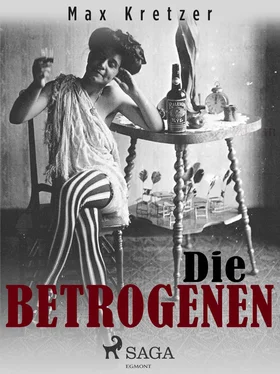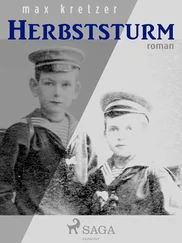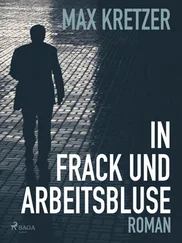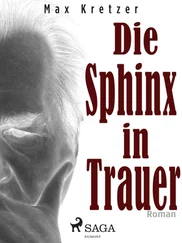1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 „O, Kind, Du weisst nicht, wie gut ich es mit Dir meine. Sie taugen alle nichts, diese Söhne reicher Väter, die arme Mädchen zu bethören suchen. Baue nie auf eines Mannes Wort, wenn er höher steht wie Du. Lerne sie verachten, hassen, verabscheuen, wenn sie sich Dir mit Hintergedanken nahen. O, Du weisst noch nicht, was das heisst, betrogen zu werden, mögest Du es nie erfahren ... Sieh, so fangen sie alle an, wie der junge Brendel: sie suchen die Vergnügungssucht in uns zu erwecken, das sind die ersten verbotenen Früchte, die sie uns Armen bieten, dann kommen Geschenke, Versprechungen, Schwüre von ewiger Treue und Liebe, bis das Herz gebrochen ist und Körper, Seele, Alles, Alles ... O, Jenny, Jenny, wenn ich sprechen könnte, wie ich möchte ...“
„Maria —.“
Es war das erste Mal, dass das junge Mädchen ihre Freundin und Nachbarin kurz mit diesem Namen wie eine Schwester anredete. Sie fühlte sich plötzlich durch die Aufrichtigkeit der Seidel, durch diesen Unterhaltungsstoff, der ihr Geschlecht betraf, dem um zehn Jahre älteren Mädchen näher gerückt wie sonst, es war ihr, als läge sie an der Brust einer treuen, wohlmeinenden Schwester.
Und Maria Seidel hatte dieselbe Empfindung; der eine Ausruf ihres Namens hatte sie in ihr erweckt. Und das machte ihr Herz noch einmal überquellen. Sie wollte diese in der Entfaltung begriffene Mädchenknospe beschützen vor dem gewöhnlichen Schicksal schöner Arbeitertöchter, sie wollte ihr, hingerissen von plötzlich wild auf sie einstürmenden Erinnerungen der Vergangenheit, irgend ein böses Beispiel vor Augen halten, ihr zur Bekräftigung des Gesagten irgend eine alte Geschichte erzählen — ihre eigene jammervolle Geschichte ..
Aber sie kam nicht soweit, denn draussen auf dem Flur ertönte der laute Ruf „Jenny!“ Gleich darauf klopfte es ziemlich derb an der Thür, und ohne erst ein Herein abzuwarten, zeigte sich in der geöffneten Spalte, von einer alten flackernden Lampe mit zerbrochenem Cylinder hell beleuchtet, das geschwärzte Gesicht des Kohlenschippers Hoff.
Er rief einen brummigen, aber freundlichen „ Guten Abend“ und hatte dann eine Bestellung für seine Tochter bereit.
„Nichts für ungut, Mamsell Seidel, wenn ich störe, aber das Mädel soll mir etwas holen. — Jenny, komm, hol’ uns ’ne Flasche Bier und ’nen kleenen Schnaps, Schott ist da.“
Das war genug. Jenny ging betrübt und die Thür klappte wieder.
Maria Seidel sass wieder allein und starrte über das niedriger liegende Dach des Quergebäudes hinweg, hinüber nach dem Häusermeer. Sie stand auf und lehnte sich zum Fenster hinaus. Ueber Berlin führte die Dämmerung den letzten Kampf mit dem Abend. Der Himmel wurde grauer und dunkler und verlor das intensive Blau des Tages. Der grosse Schleier der Nacht senkte sich allmählich herab und legte sich auf die spitzen und platten Dächer der Häuser. Die Höfe öffneten sich, von oben gesehen wie tiefe schwarze Abgründe, an deren Wänden die vereinzelt erleuchteten Fenster der Häuser sich ausnahmen wie winzige, unregelmässig angebrachte Lämpchen. Von den Strassen herüber ertönte das zweite Erwachen der Stadt mit seinem Rüsten zum Vergnügen des Abends, zum Schwelgen bis in die sinkende Nacht, in den grauenden Morgen. Heller erglänzten die scharfen Kanten der Häuser, beleuchtet vom Reflex der angezündeten Laternen. Und immer mehr Lichter zeigten sich in den Höfen, immer mehr erleuchtete Fenster tauchten spukhaft schnell in dem Dunkel auf. Dort noch zeigte sich ein Kopf im Rahmen des Fensters, von dort herüber ertönte das helle Pfeifen des Liedes vom „grünen Strand der Spree.“
Hier, wo man das Gedränge in den Strassen nicht sah, nur der Menschen Wohnstätten vor den Augen hatte, sah Alles so friedlich, einladend nach des Tages Arbeit aus, empfing man den Eindruck einer wohlthuenden Ruhe, ohne Hader, ohne Gedanken an die Misère des Daseins. Das war der Theil Berlins, der ermattet sich nach Schlaf und Träumen sehnte.
Und doch, wenn diese Häuser sprechen könnten, wenn sie erzählen könnten, was Die verschweigen, die in ihnen wohnen! Wenn diese schwarzen, steinernen Ungeheuer ihre Mäuler aufsperren würden, um lärmend und schreiend der Welt zu verkünden, was sie erlebt, gesehen und gehört! Wenn sie plaudern würden vom lächelnden Hunger, vom verborgenen Elend, von der versteckten Gemeinheit und dem unsichtbaren Verbrechen. Wie würden sie brüllen und toben, um der Welt da draussen die Maske vom Gesicht zu reissen, mit der sie sie nie in ihren Mauern gesehen haben. Was für Geschichten würden sie hinausposaunen zum Spott und Gelächter der schadenfrohen Menge, zum Entsetzen und zum Grauen derer, die sich die Gerechten nennen. Was liessen sie übrig, wenn sie dem Babel den Flitterstaat vom Leibe rissen — nichts als ihre eigene steinerne Ruhe und den Dampf und Qualm, der jedes Ideal erstickt — grausam, unerbittlich ...
Wie Maria Seidel so nach den dunklen Häusern, die sie anzuglotzen schienen, hinüberstarrte, vernahm sie im Geiste so eine alte Geschichte, die ewig neu bleibt: ihre eigene. Sie kannte sie ganz genau, sie wollte sie nicht mehr hören, aber sie konnte sich ihrer nicht entziehen — sie umbrauste ihre Ohren und nahm ihr ganzes Denken und Empfinden gefangen. Und eigene Phantasie und Erinnerung halfen dabei und liessen den Weg in die Vergangenheit in Minuten zurücklegen.
O, da war zuerst die glückliche Jugendzeit in dem kleinen Hause in der Potsdamerstrasse, das enge Freundschaftsbündniss zwischen zwei Familien auf einem Flur: zwischen dem schrullenhaften gelehrten Professor Wilmer und dem Doktor Seidel, ihrem Vater. Da war die süsse Vertrautheit mit Louise Wilmer, ihrer Busenfreundin, da waren die rosigen Erinnerungen an die Tanzstunden, Gesellschaftsstunden und Kaffeekränzchen mit ihren kleinen Geheimnissen, Ueberraschungen und Neckereien ältester Gymnasiasten und jüngster Studenten. Das war Poesie im Elternhause, reiner Rosenduft und heller Sonnenschein — nichts von der Atmosphäre, die sie heute athmen musste.
Und da tauchte auch ein hübscher Krauskopf auf, ein stolzer, muthiger Jüngling, ihr einziger Bruder Robert. Wie hatte er sie geliebt, wie war sie ihm zugethan in reiner schwesterlicher Liebe. Er war eine so ideal angelegte Natur, begeistert für alles Hohe und Schöne. Oft übermüthig in seinem Thun, aber doch ein herzensguter Junge. So gut, da der immer wählerische und eigensinnige Backfisch Louise Wilmer sich für ihn begeistern konnte. Wie hatte sie Beide mit dieser Liebe geneckt, sie ausgelacht, wenn sie mit sechszehn und zwanzig Jahren schon vom Heirathen sprachen. Vorüber ein paar Jahre. —
Robert sollte studiren, da starb der Vater. Das war der erste unbarmherzige Schlag. Vermögen war nicht vorhanden. Verdienen um zu leben, war die Parole des Tages. Sie gab Unterricht in Sprachen, soweit es in ihrer Kraft lag, die Mutter nahm Klavierschülerinnen und Robert trat mit guten Empfehlungen in ein grosses Waarenhaus als Lehrling, wo er sofort einen kleinen Gehalt bekam. Er mit seinen Idealen des angehenden Studententhums ein trockener Zahlenmensch!
Man musste sich allerhand Einschränkungen auferlegen, dazu gehörte auch das Aufgeben der zu theuren Wohnung. Das Band der Freundschaft mit Wilmers erlitt den ersten grossen Riss: man kam sich scheinbar aus den Augen. Wieder ein Jahr vorüber. Auch die Mutter todt! Die Geschwister waren jetzt ganz allein auf sich angewiesen. Sie trat in ein Geschäft, um mehr zu verdienen, und besuchte Abends eine kaufmännische Lehranstalt. Dann nahm sie eine Stellung als Kassirerin in einem grossen Laden ein. Und da sah er sie zum ersten Mal, er Hugo Wald, wie er sich nannte, und sie ihn. Er kam und kaufte öfter, als man es wohl bei Jemandem, der nur Interesse für Waaren hatte, erwarten durfte. Ihr musste das auffallen. Dann erwies er ihr Aufmerksamkeiten und näherte sich ihr mit redlichen Absichten. Sie verlor ihr Herz. Er war Kaufmann, Buchhalter in einem grossen Magazin, wie er sagte. Sie forschte nicht darnach — sie war blind, denn sie liebte zum ersten Male. Und nun kam die alte, ach so alte Geschichte. Er versprach ihr die Ehe, kaufte Verlobungsringe, nur um seinen nichtswürdigen Zweck zu erreichen, und dann als sie sich Mutter fühlte, eine Welt der Schande immer drohender vor ihren Augen auftrat, als sie immer mehr in ihn drang, sein Versprechen einzulösen, kam jener Winterabend, der ihr Blut erstarren machte, sie laut um Barmherzigkeit schreien hiess, um der Ehre ihrer Eltern Namen, um des Kindes willen, das sie unterm Herzen trug. Und es hörte sie Niemand, Niemand.
Читать дальше