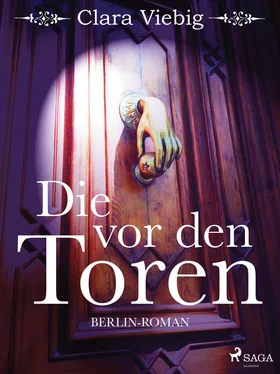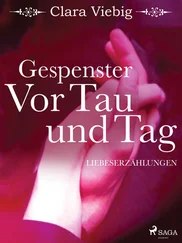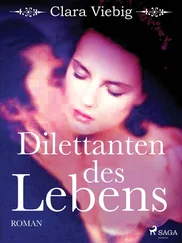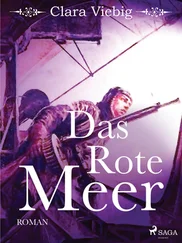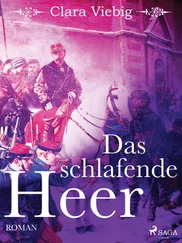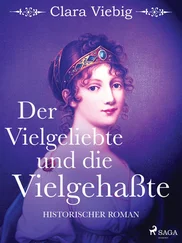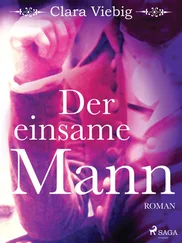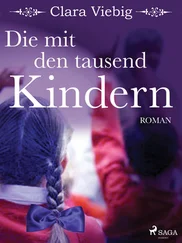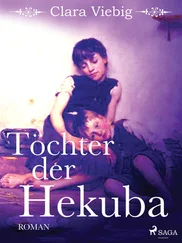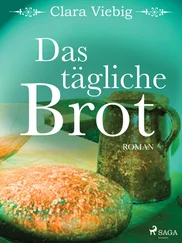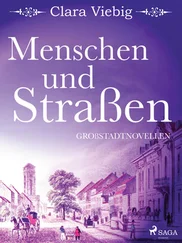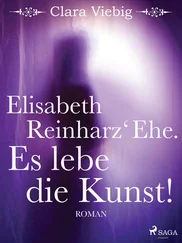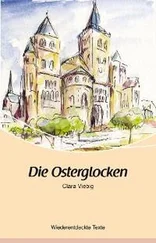Sie hatte recht. Was half das Dagegensein?! Das hatte sich Hanne Badekow gesagt gleich in derselben Stunde, da Johann zu ihr auf die Stube gekommen war, ganz rot und in einer Hast, die seinem sonstigen Wesen gänzlich fremd war.
Er hatte sich vorgenommen gehabt, Auguste zu beobachten; sie fuhr zu oft in die Klavierstunde nach Berlin und blieb zu lange. Johann hatte sich mit Lietzow verbündet; Gottfried war ja nicht bloß sein Schwager, seine Mutter war auch eine Badekow gewesen, vor ihm brauchte man also kein Hehl zu haben. Um drei fuhr der Omnibus, Auguste war zur Stunde aufgebrochen, sie ging mit ihrer Musikmappe ab.
„Haste jesehn?“ flüsterte Gottfried lachend, als sie hinter ihr drein schlichen, „wie’n Schild hält se sich de ‚Musik‘ vor’n Bauch. In Joldbuchstaben, janz jroß, det et ooch jeder sehen kann!“
Aber Johann lachte nicht, er schämte sich seiner Rolle; es war nicht angenehm, daß sie hier wie die Spürhunde nachschnuppern mußten.
Auguste stieg in den Omnibus. Als sie glücklich darin saß, kletterten die beiden Späher am Seitentreppchen hinauf aufs Dach. Nun konnten sie gut beobachten. „Die sieht ja nich nach uns, die is jetzt janz in’n Tran“, sagte Gottfried.
Sie fuhren im schwankenden Gefährt eine lange halbe Stunde über die Chaussee. Johann schalt über das langsame Zotteln, aber Gottfried tröstete: „Na, man Jeduld, du kriegst noch früh jenug dein Wunder zu sehen!“
Das war nicht schön, daß der Schwager noch uzte! Johann wurde immer grimmiger.
Am Belle-Alliance-Platz stieg Auguste aus und ging nach rechts. Wo wollte sie denn hin? Die Lehrerin wohnte doch links herum, Wilhelmstraße.
„Sie trifft ihn wo“, flüsterte Gottfried.
Hastig kletterten sie vom Deck herunter. Johann wäre beinahe fehlgetreten, er kam sich selber nicht sicher mehr vor; seine Beine zitterten. Das kam bloß von dem verfluchten Geratter, der Omnibus stieß auf dem harten Pflaster! Aber die Beine zitterten ihm auch noch, als sie nun gingen, immer hinter Auguste drein. Vorsicht war kaum nötig, sie sah sich nicht um. „Sie rennt ja wie besessen“, ächzte Gottfried. Sie kamen ganz außer Atem.
Nun bog sie in die Lindenstraße ein.
„Donnerwetter!“ Johann faßte nach Gottfrieds Arm: da wohnte der Kerl ja – Lindenstraße 104! Da war die Nummer! Auguste hielt an. Sie huschte ins Haus. Sie lief die Treppen hinan – drei Treppen.
Auf dem zweiten Absatz blieben die Verfolger zurück. Sie stiegen erst hinauf, als oben die heisere Klingel ausgeschrillt und eine Tür geklappt hatte. Auguste war drinnen.
„Also hier spielt se Klavier?!“ sagte Gottfried.
„Sei man bloß stille!“ Johann war ganz blaß. Sie studierten die Schilder. Links wohnte „Prim, Herrenschneider“ – aber hier rechts: „Amanda Schulze“ – und eine Visitenkarte war darüber, mit Reißzwecken angepiekt:
Julius Paschke.
Sie hatten dann auch geklingelt und sie herausgeholt. Es war eine schreckliche Situation gewesen. Gottfried hatte dem Kerl ein paar gehörige Grobheiten an den Kopf geworfen, die dieser mit einer Ruhe, die Gottfried noch mehr in Rage brachte, einsteckte. Gewiß, er konnte es begreifen, daß es den Herren nicht angenehm war, das Fräulein hier bei ihm zu finden, aber er konnte sie versichern – er gab sein Ehrenwort – es war nichts passiert. Gar nichts. Dafür stand ihm seine Braut, Fräulein Auguste Badekow, viel zu hoch.
Ein unverschämter Fatzke! Lietzow schrie ihm ein: „Halten Sie Ihre Schnauze!“ entgegen. Aber dann wußte er auch nichts weiter zu sagen: wahrhaftig, sie waren die Blamierten. Was nun?!
Auf Johann war nicht zu rechnen, er brachte kein Wort vor. Wie begossen stand er; es kränkte ihn doch zu tief: seine Schwester, eine Badekow aus Tempelhof, rannte zu einem Kerl hin?! Stumm führte er die weinende Auguste fort. Er hätte auch weinen mögen. Den ganzen weiten Weg hielt er sie fest ums Handgelenk.
Gottfried trug die Musikmappe hinterher. Sie hatte am Boden gelegen, er hatte sie aufgerafft, man konnte sie doch nicht dalassen. –
Aber nun war das alles vergessen, oder schien doch vergessen. Auguste triumphierte: sie hatte es durchgesetzt, sie hatte ihren Julius erobert. Und so romantisch war das alles. Romantischer konnte es nicht zugegangen sein damals, als der Tempelhofer, der stolze Ritter, die Tempelhofer Bauerntochter am Klarensee getroffen und geliebt hatte. Träumend zog sie Vergleiche: ach, ihr Julius, war er nicht auch wie ein vornehmer Herr?! Ganz geblendet war sie von ihm; sie hatte kaum einen eigenen Willen mehr, demütig ordnete sie sich ihm unter.
Die Mutter sprach ernst mit ihr, sie hörte nicht zu. Wenn Hanne Badekow auch nichts Böses von Paschke dachte – er war im Grunde seines Herzens ein ganz guter Mensch und, lieber Gott, einer, der sich gern hatte selbständig machen wollen – sie hatte doch Sorge: er war sicherlich etwas leicht. Beweise hatte man zwar nicht; so sehr Johann und Gottfried nachstöberten, auch den Jakob in Berlin auf die Spur hetzten, sie hörten überall nur das gleiche: „Ein netter Kerl!“ –
Hanne Badekow betete nicht viel, aber als sie nun heute in der alten Dorfkirche, in der sie selber vorm Altar gestanden hatte und in der schon zwei ihrer Töchter getraut worden waren, die dritte Tochter stehen sah im Myrtenkranz, fing sie an zu beten in einem unbestimmten Herzensdrang.
Sie hob den Blick: da hing rechts vom Altar der Gedächtnisschrein mit dem Lorbeerzweig, der das Kreuz umschlingt:
Den Heldentod für König und Vaterland starb
Wilhelm Karl Badekow,
geboren am 14. Mai 1850,
gefallen bei Mars-la-Tour am 18. August 1870.
Ach ja, der Wilhelm! Und es war ihr, als spräche eine Stimme in ihr: um die Kinder, die gestorben sind, trägt man nicht den meisten Kummer – wie hatte die Auguste ihr das nur antun können und zu dem fremden Menschen hinlaufen?! Wenn das jemand wüßte?!
Förmlich verängstigt ließ die Badekow ihre Blicke umhergehen. Die Kirche war gedrängt voll, alle Frauen und Mädchen von Tempelhof wollten Badekows Guste im Brautstaat sehen. Die Mutter sah viel Neugier, aber – Gott sei Dank! – Schadenfreude sah sie nicht.
Jetzt steckte der Geistliche ihnen die Ringe an – Gott sei Dank, jetzt war die Auguste Frau!
Ganz befriedigt faltete Mutter Badekow ihre derben Hände über der Rundlichkeit ihres starren, brokatseidenen Kleides. Veilchenblau war das, mit eingewirkten gleichfarbigen Blumen. Die Kinder hatten es nicht anders getan, heute durfte die Mutter nicht mehr in schwarz gehen. Und an der Haube hatte sie eine Goldspitze.
Es war eine stattliche Hochzeitsgesellschaft. Die Millionenwitwe, nach der die meisten Hälse sich reckten, trug ein Kleid, so kornblumenblau, so leuchtend von Farbe, daß es die Augen fast blendete. Es war an der Taille und an den Ärmeln mit Rosa passepoiliert. Über dem Rock, den acht spitzenbesetzte Volants garnierten, bauschte sich hinten mächtig der Überwurf; im Ausschnitt en coeur zwischen weißen Spitzen hing an dickgoldener Kette ein goldenes Medaillon, wohl ein viertel Pfund schwer.
Lene Lietzow war auch nicht wenig fein in Smaragdgrün, und Johanns Frau, die rotwangige Grete, trug ein Rubinrot, das die lebhaften Farben ihrer Wangen noch erhöhte.
Alle in Seide. Auch die Braut; schwer und lang hing ihre Schleppe über die ausgetretenen Steinstufen des Altars. Auguste stand der Brautstaat nicht vorteilhaft, das Milchweiß des starren Kleides machte sie grau. Zudem hatte die Schneiderin aus Berlin, die alles konnte, sie unkleidsam frisiert; sie sah alt aus, wie eine Haube war ihr der Brautschleier über den Kopf gezogen.
Paschke in Frack und weißer Krawatte machte sich dagegen sehr gut. Das Murmeln der Bewunderung galt ihm: wie ein Leutnant in Zivil! Was die Auguste für einen Dusel hatte! Sie schien aber auch ihr Glück zu schätzen. Sonst weinen doch immer die Bräute, schon anstandshalber, die aber strahlte übers ganze Gesicht.
Читать дальше