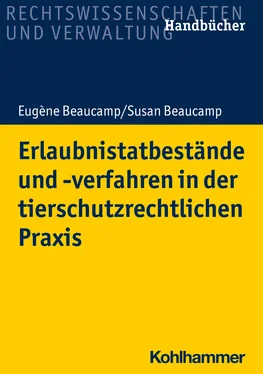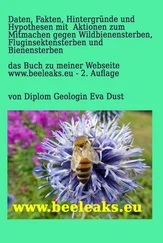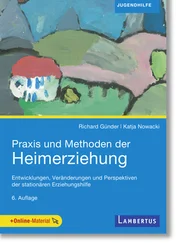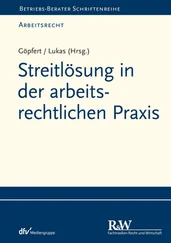40 b) Gehegewild.Der Begriff Gehegewild ist nicht klar abgegrenzt. § 43 Abs. 1 BNatSchG definiert lediglich den Begriff des Tiergeheges. Gemäß der in Bayern geltenden Richtlinie für die Haltung von Dam-, Rot-, Sika sowie Muffelwild vom 10.1.2014 (GehegewildR) werden die genannten Wildarten als Gehegewild betrachtet. Das „Merkblatt Gehegewild – Haltung und Vermarktung“ des Landkreises Celle, Stand März 2015, behandelt neben den in der GehegewildR genannten Wildarten auch Wildschweine, Strauße und – wegen seines territorialen Verhaltens – mit Einschränkungen Rehwild als Gehegewild. Der Ortenaukreis nennt in seinem „Merkblatt Gehegewildhaltung“, Stand 2018, sämtliche Wildklauentiere, die in Gehegen zum Zwecke der Gewinnung von Fleisch für den menschlichen Verzehr gehalten werden, als Gehegewild. Der Landkreis Rostock behandelt in seinem „Merkblatt Gehegewildhaltung“, Stand Dezember 2015, Schwarzwild, sowie Dam-, Rot-, Sika- und Muffelwild als „Wildklauentieren“. Gemäß Abs. 6 S. 1 ist die gewerbsmäßige Haltungvon Gehegewild vor der Aufnahme anzuzeigen. Form und Inhalt der Anzeige, die Voraussetzungen für die Untersagung der Tätigkeit und das Verfahren im Falle nachträglicher Änderungen des angezeigten Sachverhalts können durch Rechtsverordnung geregelt werden, Abs. 6 S. 2. Von dieser Verordnungsermächtigung hat das zuständige Bundesministerium bisher keinen Gebrauch gemacht.
41Zu den Begriffen Halten und Zucht siehe oben die Erläuterungen zu Nrn. 1 a) und b), 2; Rn. 5, 4.
42 c) Tierschutzvereine.Unter Nr. 8 a) können auch Tierschutzvereine fallen. Das OVG Nordrhein-Westfalen hat mit Beschluss v. 17.2.2017, 20 A 1897/15 entschieden, dass die Verwahrung von Fundtieren durch einen Verein bei vertraglich gebundenen Pflegestellen gegen die Kosten übersteigenden Aufwendungsersatzdurch Gemeinden als gewerbsmäßiges Halten von Wirbeltieren zu qualifizieren ist. Es sei unerheblich, dass der Verein primär einen außenwirtschaftlichen Zweck – Tierschutz – verfolge. 86
43 d) Qualzucht.Im Kontext mit dem Erlaubnistatbestand in Nr. 8 a) – gewerbsmäßige Zucht – ist auf die Vorschrift des § 11 b hinzuweisen, die das Verbot der „Qualzucht“ normiert. 87Ziel der Einführung von § 11 b war es zu verhindern, „dass Veränderungen von Köpermerkmalen bestimmter Haustiere bewusst in Kauf genommen oder gar gefördert werden, obwohl sie für die betroffenen Tiere mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sein können“. 88Die Vorschrift ist damit eine Konkretisierung von § 1 Abs. 1 und der für das gesamte TierSchG definierten Zielsetzung, die Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf wahrzunehmen und seine Würde und sein Wohlbefinden zu schützen. Im Sinne eines vorbeugenden Tierschutzes sind auch die Nachkommen einschließlich der noch ungeborenen Nachkommen von Wirbeltieren in den Schutz von § 11 b einbezogen, indem die Vorschrift gleichsam das „In-Gang-Setzen“ einer für spätere Generationen schädliche Vererbung unter Verbot stellt.
44Anders als § 1 S. 2 lässt § 11 b Einschränkungen des Verbots unter dem Gesichtspunkt eines „ vernünftigen Grundes“ nicht zu. 89Das Verbot gilt vorbehaltlos. Der Würde und dem Wohlbefinden des Tieres wird damit im Bereich der Zucht und der Anwendung biotechnischer Verfahren grundsätzlich Vorrang vor menschlichen oder wirtschaftlichen Interessen eingeräumt. Eine Ausnahme von dem Verbot gilt gemäß Absatz 3 für durch Zucht oder biotechnische Maßnahmen veränderte Tiere, „die für wissenschaftliche Zwecke notwendig sind“. Der Verstoß gegen § 11 b wird als Ordnungswidrigkeit geahndet, § 18 Abs. 1 S. 1 Nr. 22. Soweit Zucht oder biotechnische Maßnahmen bei den betroffenen Wirbeltieren zu länger anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen oder Leiden führen, kann neben der Verletzung des Verbots des § 11 b auch eine Straftat nach § 17 Nr. 2 b) vorliegen. 90
45Gemäß § 11 b ist es verboten, Tiere zu züchten oder durch biotechnische Maßnahmen zu verändern, wenn nach züchterischen oder biotechnischen Erkenntnissen zu erwarten ist, dass als Folge der Zucht oder biotechnischen Veränderung bei der Nachzucht, den biotechnisch veränderten Tieren selbst oder deren Nachkommen die in § 11 b Abs. 1 Nrn. 1 und 2 definierten Folgen eintreten. „Qualzucht“ liegt danach vor, wenn erblich bedingt Körperteile oder Organe fehlen oder untauglich sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden eintreten, Nr. 1. Des Weiteren liegt „Qualzucht“ vor, wenn bei den Nachkommen Verhaltensstörungenauftreten, die Leiden verursachen, artgemäße Sozialkontakte bei den Tieren selbst oder Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden führen oder die Haltung der Tiere nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt, Nr. 2.
46Eine Auslegungshilfe zu § 11 b gibt das von der vom BMEL eingesetzten Sachverständigengruppe „Tierschutz und Heimtierzucht“ erarbeitete „Gutachten zur Auslegung von § 11 des Tierschutzgesetzes 91vom 2.6.1999, das allerdings nur Qualzuchten im Heimtierbereichbehandelt. Fische und Reptilien werden in dem Gutachten nicht behandelt, was auch damit zusammenhängt, dass Qualzuchten bei diesen Tierklassen erst nach der Vorstellung des Gutachtens in größerem Umfang praktiziert bzw. bekannt wurden. Pläne, das Qualzuchtverbot auch für landwirtschaftlichen Nutztieren– insbesondere Rinder, Schweine, Masthühner, Puten – zu konkretisieren und Zuchtverbote zu formulieren, scheinen auf Betreiben des zuständigen Bundesministeriums nicht weiterverfolgt worden zu sein. 92
47 e) Typologie der Qualzuchten.Die nachfolgende Typologie der „Qualzuchten“ soll nur einen Überblick zu Qualzuchten im Heimtierbereich geben, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber einen Eindruck von der Tragweite dieser Problematik vermittelt. Einen instruktiven Überblich zu Qualzuchten im Nutztierbereich gibt Hirt/Maisack/Moritz, § 11 b, Rn. 23 ff.
48 aa) Hunde.Das Gutachten zu § 11 b empfiehlt bei Hunden zahlreiche Zuchtverbotefür Tiere, die Träger von bestimmten Genen oder eindeutig erblichen Merkmalen sind:
– Blue-dog-Syndrom; blaugraue Farbaufhellung mit Disposition zur Alopezie (Haarlosigkeit) und Hautentzündung insbesondere bei Dobermann, und anderen Rassen wie Dogge, Greyhound, Irish Setter, Pudel u. a.; Zuchtverbot für Merkmalsträger, Tz. 2.1.1.1.1 des Gutachtens
– Verkürzungen und Verkrüppelung der Schwanzwirbelsäule (Korkenzieherschwanz, Knickschwanz), Knick-Korkenzieherschwanz bei Franz. Bulldogge, Engl. Bulldogge, Mops, Teckel u. a., Stummelschwänze bei Bobtail, Cocker Spaniel, Entleburger Sennenhund, Rottweiler u. a.; Zuchtverbot für Tiere, die auch Wirbeldefekte an weiteren Abschnitten der Wirbelsäule aufweisen, Tz. 2.1.1.1.2 des Gutachtens
– Disproportionierter Zwergwuchs (Chondrodysplasie bei Basset Hound, Franz. Bulldogge, Pekinese, Scottish Terrier, Teckel, Welsh Corgi u. a.); Zucht gegen die Merkmalsausprägung, Tz. 2.1.1.1.3 des Gutachtens
– Dermoidzysten (Hauteinstülpungen am Rücken, die bis in den Wirbelkanal reichen können) bei Rhodesian Ridgeback; Zuchtverbot für Merkmalsträger, Tz. 2.1.1.1.4 des Gutachtens
– Grey-Collie-Syndrom (silbergraue Farbaufhellung verbunden mit schweren Störungen der Hämatopoese Blutbildung) bei verschiedenen Collie-Zuchtlinien; Zuchtverbot für silbergraue Tiere und bekannte Defektgenträger, Tz. 2.1.1.1.5 des Gutachtens
– Haarlosigkeit bei allen Nackthundrassen wie Chinesischer Nackthund oder mexikanischer Nackthund; Zuchtverbot für alle Defektgenträger, Tz. 2.1.1.1.6 des Gutachtens
– Merle-Syndrom (Pigmentierungsanomalien, die regelmäßig mit variabel ausgeprägten Sinnesorgandefekten (Auge und Ohr)) einhergehen bei Bobtail, Collie, Deutsche Dogge, Dunkerhund, Sheltie, Teckel, Australian Shepherd u. a.; Zuchtverbot für „Merle-Weißtiger“ und den Paarungstyp Tiger x Tiger (Mm x Mm) und Empfehlung eines generellen Zuchtverzichts mit dem Merle-Gen, Tz. 2.1.1.1.7 des Gutachtens
Читать дальше