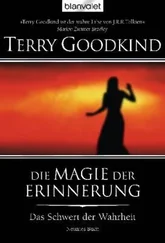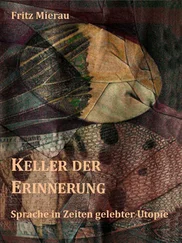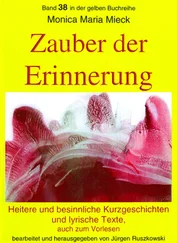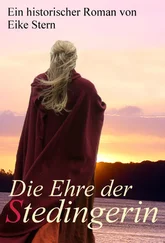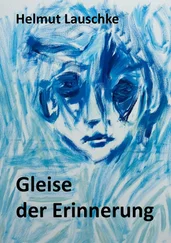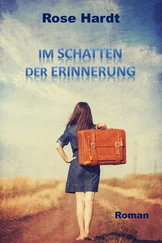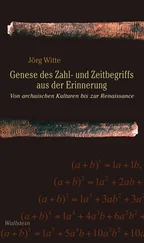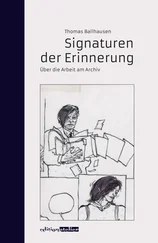Den Siegern Einhalt zu gebieten, ist der verzweifelte Gestus in den Memoiren Hersch Mendels. Die Erinnerungen umfassen wie sein eigenes, so das Leben der jüdischen Arbeiterbewegung. Seine Kindheit ist die Kindheit des »Bund«, jener ersten großen jüdischen sozialistischen Organisation, bei der die russischen Sozialdemokraten in die Schule gingen und ihre ersten illegalen Flugschriften drucken ließen.
Alle politischen Umbrüche, vom Bankrott der Zweiten Internationale bis zur Unterwerfung der kommunistischen Parteien unter das Diktat Stalins, sind Umbruchsituationen im Leben Hersch Mendels. Über verschiedene Stationen führt sein Weg aus dem lumpenproletarischen Milieu Warschaus, das man so trefflich geschildert allenfalls noch bei einem längst vergessenen Schriftsteller, bei Schalom Asch (»Mottke der Dieb«) nachlesen kann, bis in die antistalinistische Opposition, die er in Polen zusammen mit dem späteren marxistischen Historiker Isaac Deutscher begründet. Jedoch behauptet sich in den Brüchen seiner Biographie eine seltene Kontinuität: Die Solidarität mit allen Beleidigten. Für Mendel, der frei war von Karrieredenken, politischen Opportunismus, der nie aus Mitleid verschämt, sondern aus Scham empört war und ein Gegner jeglicher Bürokratie, war diese Solidarität die Quelle seines von nationalistischen Tendenzen ungetrübten Kampfes für die Rechte des jüdischen Volkes in Osteuropa.
Im damaligen Zwischenkriegspolen lebten ungefähr 3,5 Millionen Juden, etwa eine Million mehr als im Israel des Jahres 1971. Von ihnen und den aus verschiedenen Ländern nach Polen deportierten 700.000 Juden waren im August 1943 nur noch ungefähr 300.000 am Leben. Der Vertreter des »Bund« in der polnischen Exilregierung in London, Schmuel Zygelboim, der sich wegen der Passivität der Welt gegenüber dem Schicksal der Juden und weil er erkannt hatte, daß in den Überlegungen der Alliierten kein Platz für sie war, am 12. Mai 1943 das Leben nahm, schrieb in seinem politischen Testament:
»Ich kann nicht schweigen. Ich kann nicht mehr leben, während die letzten Überlebenden des jüdischen Volkes in Polen, dem ich angehöre, ausgerottet werden. Meine Kameraden im Warschauer Ghetto haben in einem letzten Akt des Heroismus zu den Waffen gegriffen. Mein Schicksal war es nicht, mit ihnen zu sterben, aber ich gehöre zu ihnen und ihren Massengräbern... Ich weiß, daß ein Menschenleben in unserer Zeit wenig bedeutet. Da ich jedoch zu meinen Lebzeiten nichts tun konnte, trage ich vielleicht durch meinen Tod dazu bei, daß die Gleichgültigkeit derjenigen gebrochen wird, die die Möglichkeit haben, vielleicht im letzten Augenblick, die noch am Leben gebliebenen polnischen Juden zu retten.«
So wenig wie der millionenfache hat sein einzelner Tod die Gleichgültigkeit der Welt erschüttert, und seine Zeitgenossen wie die Nachwelt haben seine Hoffnungen gründlich verhöhnt. Die Deutschen konnten das Morden fortsetzen, Auschwitz wurde nie bombardiert, und die KZ standen, wie es sogar dem CDU-Politiker Blüm versehentlich einfiel, nur solange die Front hielt.
Der jüdische Historiker Joseph Wulf, Verfasser mehrerer längst vergriffener und von der etablierten Geschichtswissenschaft nie ernstgenommener Bücher über den Nationalsozialismus, berichtete einmal, daß er im KZ Zeuge geworden sei, wie die Deutschen den berühmten 72jährigen jüdischen Gelehrten Simon Dubnow, den Autor einer vielbändigen »Weltgeschichte des jüdischen Volkes« inmitten einer Gruppe von Juden in die Gaskammer getrieben hätten. Dubnow habe sich im letzten Augenblick umgedreht und gerufen: »Schreibt alles auf.« Wenn schon die Passivität der Welt ein Einhalten des Mordens verhindert hatte, so sollten die Opfer in der Erinnerung nicht nochmals getötet werden durch Vergessen. Aber auch die Hoffnung auf Erinnerung erwies sich als Illusion; über dem geringen öffentlichen Interesse an seinen Forschungsarbeiten beging Joseph Wulf Selbstmord.
1939 begann das Ende, und hier endet auch die Biographie Hersch Mendels. Er ist in den 50er Jahren als zweifach gebrochener Revolutionär, als Überlebender ohne Volk nach Israel emigriert und hat damit, wie er in einer kurzen Nachbemerkung schreibt, die Konsequenz aus seiner vor Hitler undenkbaren Hinwendung zum Zionismus gezogen, ohne sich jedoch zur speziell jüdischen Dissidentenausgabe von der israelischen Propaganda herabwürdigen zu lassen. Er war kein Renegat. In seinem Postscriptum kündigt er den zweiten Teil seiner Erinnerungen an. Sie sind, das ist kein Zufall, nie geschrieben worden. 9
Hersch Mendel, wie wenige andere zufällig der Ermordung entkommen, hat kein Buch über die Methoden der deutschen Verbrechen, warnend vor der historischen Möglichkeit einer endgültigen Vernichtung, geschrieben. Seine Erinnerungen handeln vielmehr von der endgültigen Vernichtung einer historischen Möglichkeit. Er hat, was unwiederbringlich ist, aufgezeichnet und von der Vergänglichkeit der historischen Voraussetzungen geschrieben, welche der Alternative »Sozialismus oder Barbarei« zugrunde lagen. Diese Frage ist entschieden.
1980
Vergessen, vergeben, verdummen
Lieber Peter Dahl, 10
Du hast mir ein Leseexemplar von Hans Rosenthals Erinnerungen »Zwei Leben in Deutschland« in der Annahme zugeschickt, daß ich eine Besprechung für Konkret schreiben würde. Warum ich das nicht tun werde, will ich begründen:
Es gibt mit Sicherheit Tausende von Büchern, die besser sind als die Memoiren von Rosenthal, ohne daß ein vernünftiger Redakteur auf den Gedanken käme, ein Wort darüber zu verlieren, welches er sich, sofern er nicht seine Tante oder einen nahen Freund protegieren möchte, für wirklich gute Bücher reserviert. Zahlte mir ein Verlag ein kleines Vermögen, dann würde ich selbst – wie weiland Petronius die dämlichen Verse von Nero gelobt hat – Peter Schneider zum Dichter erheben, aus Carstens einen Demokraten machen und schließlich aus der Betriebsnudel Rosenthal einen Unterhaltungskünstler von Broadwayformat. Aber leider gibts hierzulande keine entwickelte Korruption, sondern nur, wie sich im vorliegenden Fall an einer Besprechung in der Illustrierten Stern sehen läßt, unveräußerliche Übereinstimmung. Dort hat ein Redakteur, dessen Nachname hoffentlich nicht zu unangenehmen Verwechslungen mit Dir Anlaß geben wird, den Köder der Werbeabteilung des Gustav Lübbe Verlags nur für sein Monatsgehalt geschluckt: Rosenthal, die quirlige Frohnatur, nimmt den Deutschen nicht übel, daß sie ihn nur zufällig nicht umgebracht haben. Endlich eine jüdische Absolution, die in mehr Ohren klingt als die Loyalitätserklärung jüdischer Funktionäre für einzelne prominente Ex-Nazis wie Filbinger.
Die ganze Nation, oder vielmehr ihr antikommunistischer Teil, wird für koscher erklärt. Das will die Regierung, das will die Bevölkerung, das will ein reaktionärer Verlag. Und im Stern steht, damit es vollends demokratisch zugeht, warum es allen recht ist: »Andere deutsche Juden, die vor 1945 ähnliches erlebt haben, verfielen in Depressionen, in Aggressionen gegen ihre Landsleute. Er nicht.« (Die einzige Pressefreiheit, derer sich der Stern erkühnt, besteht in einer Variierung der u.a. vom nachmaligen Adenauer-Staatssekretär Globke formulierten Ausführungsbestimmungen zu den berüchtigten »Nürnberger Gesetzen«: Alle Juden mußten ihrem Eigennamen die jüdischen Namen Israel bzw. Sarah einfügen. Der Stern -Redakteur hielt »Isaac« für passender.)
Daß die Zeitschrift Konkret die Erinnerungen von Rosenthal rezensieren möchte, hat seinen Grund, glaube ich, weder in der Darstellung des »ersten« Lebens von Rosenthal, denn über das Schicksal der Juden und das Verhalten der Deutschen gibt es bessere Bücher, authentische Zeugnisse, deren schandbar geringe Auflage ebenso charakteristisch für die Verfassung der deutschen Bevölkerung ist wie die abgeholzten Wälder für die 100.000 Exemplare starke Erstauflage des vorliegenden Buches; noch, denke ich, besteht ein Interesse am wirklichen Verlauf des »zweiten« Lebens, denn da gibt es bessere Karrieren. Ernstzunehmende Kritik der Kulturindustrie würde sich an der conference als leerer Betriebsamkeit, wie sie Rosenthal verkörpert, zuallerletzt entzünden, (er nennt sich selbst »Hans Dampf in allen Gassen« und fällt anderen vor allem dadurch auf, daß er alles organisieren kann, von den Brötchen bis zur Stimmung).
Читать дальше