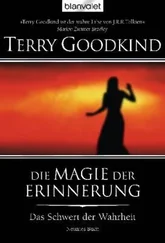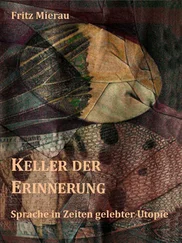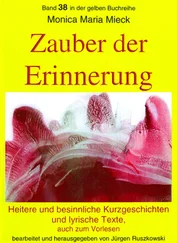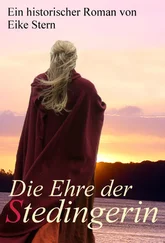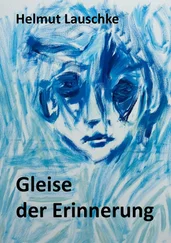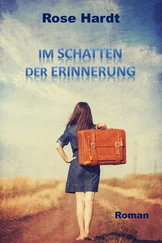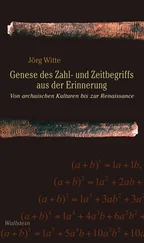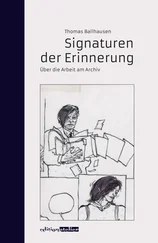Paradise lost– Offensichtlich war, dass es Oben nichts zu holen gab. Die Geschichte des deutschen Bürgertums: eine lückenlose Chronik der Selbstentmündigung.
In der Mitte schon immer potentielle Nazis.
Also machte man sich an Unten zu schaffen und entdeckte die Arbeiterbewegung. Deren Repräsentanten stimmten gerade mit 35jähriger Verspätung einem Ermächtigungsgesetz zu. »Wer hat uns verraten? – Sozialdemokraten!«, war eine der populären Empörungen. Sie wurden auf der Straße skandiert von jenen, die nicht wahrhaben wollten, dass die deutsche Arbeiterbewegung nicht mehr war, was sie nie gewesen war. Lange bevor es Volkswagen und Neckermann-Reisen gab, hatten die deutschen Arbeiter ihr Erstgeburtsrecht wirklich für einen Eintopf verkauft.
Wer hat recht? – Der liebe Knecht!
Ein Landaufenthalt– Wie einer, am Ende seiner Kräfte und mit dem letzten, verzweifelten Versuch, endlich – so oder so – eine Entscheidung herbeizuführen, das Angebot eines alten Freundes, sich für gewisse Zeit in dessen Haus auf dem Lande, von welchem er gar nicht gewußt, zurückzuziehen, nach einigem Bedenken, fast schon erleichtert, annimmt; wie er, wirklich auf dem Lande angelangt, das abgeschieden in einem Wäldchen stehende Gebäude mit wachsender Ruhe in Augenschein nimmt; wie er für die künftigen Tage, fast schon befreit, in den fremden Räumen den wenigen mitgebrachten Dingen einen zweckmäßigen Platz zuweist; wie er in der Nacht, kaum, daß er eingeschlafen ist, von Schritten geweckt wird, die er ums Haus schleichen hört, sich vorsichtig erhebt, sich zur Tür tatstet und, das Ohr an sie pressend, draußen, in unmittelbarer Nähe, deutlich Atemzüge vernimmt, nicht weiß, wie lange er so verharrt, und in der Frühe, sobald das Morgengrauen durch die Bäume dringt, fluchtartig abreist, ohne zu wissen, wohin.
Höhenluft– Daß man den Dingen nicht mehr auf den Grund kommen soll hat selbst einen, nämlich keinen. Realitätssüchtig ist, wer am Rande des Abgrunds auf dem Teppich bleibt, wer mit beiden Beinen auf des Messers Schneide steht und mit geschlossenen Augen die Gratwanderung entlang der Bodenlosigkeit absolviert. Die Blinden sind die Hellseher von heute, wer also nichts wissen will, weiß alles.
Wenn man darüber leicht den Verstand verlieren kann, so setzt das voraus, dass man ihn zuvor besessen hat. Wer heute Vernunft oder Wahrheit oder irgendwas ernst nimmt, kommt unversehens und sei es nur dadurch, dass er vor der höchsten Gefahr erbleicht, in der Rolle des Spinners, des Sektierers, des Querulanten. Nicht weil der anstößige Gedanke schon immer diskriminiert war, sondern weil er überhaupt liquidiert ist. Nicht das Denken ist in Gefahr, es ist selbst zu einer geworden. Weil vernünftige Bestimmungen sich nicht mehr vernünftig aus dem Bestehenden herleiten lassen, ist der Schritt von der Reflexion zum Wahn sehr klein.
Adorno hat über das Scheitern der Theorie vor dem Nationalsozialismus gesagt, dass, wer nicht subjektiv dem Wahnsinn verfallen wolle, der objektiv herrscht, sich immer wieder aufs Begreifen des nicht zu Begreifenden zurückgeworfen sehe. Dieser fast tröstlichen Formulierung hat er vergessen hinzuzufügen, dass man dabei noch immer auf der Schwelle zum Wahn sich befindet, den man bekämpft. Das ist die objektive Situation einer Welt, in welcher noch die prospektiven Opfer, aus Angst vor der angemessenen Angst, mutig aufs Denken verzichten, anstatt aus dem Rahmen zu fallen.
Die Unversöhnlichkeit dieses Zustandes versetzt das Individuum schon längst nicht mehr in den Zustand der Unversöhnlichkeit. Unpässlichkeit ist die Grenze des Erlaubten und macht schon Literatur. Gefragt sind Artisten, die es sich auf dem Hochseil gemütlich machen. Gedanken sind krumm. Die Abweichung kommt vor dem Fall.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und freischwebend sind bloß die Engel.
Um wieviel die Welt ärmer geworden ist
Erinnerungen eines jüdischen Revolutionärs
Memoiren sind gefragt, wenn es auf das Individuum zu allerletzt ankommt. Je weniger die gesellschaftliche Objektivität noch Raum läßt, »Ich« zu sagen, desto größer der einträgliche Geständniszwang der Zeitgenossen, die ihr Seelenleben entblättern, oder was sie dafür halten. Wie die Gesellschaft auf den universellen Gedächtnisverlust mit Gedenkfeiern antwortet, so reagiert das autistische Etwas, das an seiner Gleichschaltung leidet, auf die objektive Gedankenlosigkeit mit subjektiver Bedenkenlosigkeit. In der gegenwärtigen Befindlichkeitsliteratur kommt endlich jener unsägliche Satz Rilkes zu seiner vollen Wahrheit: »Armut ist ein stiller Glanz von innen«, oder wie es die Großstadtflüchtigen von heute den Alternativen von damals nachzwitschern: »Der Reichtum kommt von innen her.«
Wenn man über den Verlust der Erinnerung redet, der marktgängig mit so vielen Memoiren kaschiert wird, wenn das Ende der Geschichte sich mit so zahlreichen Geschichtchen geltend macht, dann müssen wir uns jenseits aller Augurenschau auf Theorie besinnen. Vom jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn, der gegenwärtig überall gefeiert und deshalb nirgendwo gelesen wird, stammt die Bemerkung, daß die Menschen in Kindertorheiten verfielen, sobald die Theorie vulgär werde. Er fügt hinzu: »Dann will man lieber von toten Gespenstern umgeben sein, als in einer toten Natur zwischen lauter Leichnamen wandeln.« Er hat damit nicht den Nationalsozialismus meinen können, aber wir müssen es. Denn die anthropologischen Leerstellen der Gegenwart, der Gedächtnisverlust und die nicht mehr poetische, sondern wörtliche Gedankenverlorenheit sind vom Nationalsozialismus zwar nicht erfunden, wohl aber in einem Ausmaß zur Grundlage moderner Herrschaft geworden, daß noch die übernächste Regierung davon profitieren könnte. Der Nationalsozialismus hat auf eine zuvor nie gekannte Weise mit der Drohung ernstgemacht, daß den Menschen Schlimmeres als der Tod widerfahren könne. Den sicheren Tod vor Augen, sollten die Opfer schon vor ihrer Vernichtung aufgehört haben, noch irgend an Menschen zu erinnern. Zu jenem Bild gemodelt, das die Nazis davon hatten, sollte spurlos verschwinden, was kein Recht auf Erinnerung hatte, denn die Opfer waren nicht jemand, sondern etwas. Wie um den Nazis recht zu geben, hat die Welt nach dem Krieg die einzige Hoffnung der Ermordeten gründlich verhöhnt und sie noch um ihren schlimmsten Fluch enteignet: Das »Nicht gedacht soll deiner werden« steht über den Massengräbern und nicht über dem gemütlichen Lebensabend der Henker.
Weil Erinnerung und Eingedenken ein gnadenloses Strafgericht heraufbeschwören könnten, vor dem keiner bestehen würde, weil ohne Gedächtnis allein sich überleben läßt, deshalb darf der Einzelne in seiner fensterlosen Biographie stochern und anderen Einzelnen versichern, daß er von vergleichbarer Trivialität sei. Das gilt für Albert Speer wie für Hildegard Knef, für Helmut Schön wie für Henriette von Schirach. Sie reden viel, aber zu sagen haben sie nichts. Ungewollt gleicht ihnen darin die aufblühende Entblößungsliteratur der »Neuen Sensibilität« Beide eint eine leutselige Selbstdarstellung armseliger Verhältnisse, der geschwätzige Ausdruck eines stummen Zwangs.
Hersch Mendel hingegen redet in seinen »Erinnerungen eines jüdischen Revolutionärs« darüber, um wieviel die Welt ärmer geworden ist. Nicht von der Verarmung im Wohlstand ist darin die Rede, jenem beliebten Thema, das von wirklicher Armut nichts mehr wissen will. Hersch Mendel schreibt über Fehlendes, über eine unheilbare Wunde des 20. Jahrhunderts, über Bedeutendes, was vernichtet, was buchstäblich zu Nichts geworden ist: Die Kultur des osteuropäischen Judentums und ihr virulentes Subjekt, die jüdische Arbeiterbewegung. Der Massenmord der Deutschen ging einher mit der Zerstörung der jiddischen Kultur; Genozid plus Ethnozid würden die Experten in einer Fernsehrunde beiläufig und mit professioneller Kühle sagen und damit die allgemeine Unfähigkeit dokumentieren, trotz und wegen »Holocaust«, die Zahl der Opfer als ausgelöschte Möglichkeiten einer menschenwürdigen Geschichte zu begreifen. 8
Читать дальше