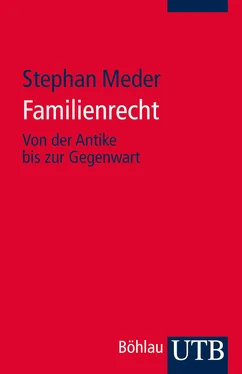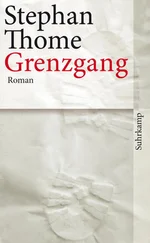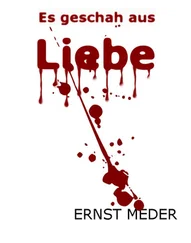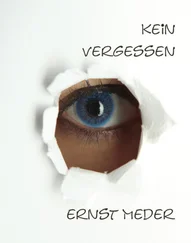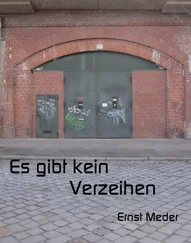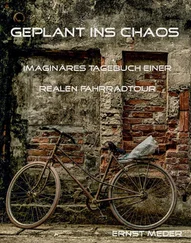Frankreich, England, die USA und Deutschland sind die Länder, in denen Frauen nach 1848 erste Forderungen zur Verbesserung ihrer Rechtsstellung formulieren. Während in England und in den USA, zumindest im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, der Kampf um die Einführung des Stimmrechts dominiert, werden in Frankreich auch vielfältige Forderungen zur Reform des Ehe- und Familienrechts unterbreitet (6. Kapitel, S. 161). Insoweit besteht eine Gemeinsamkeit mit Deutschland, wo die Frauenbewegung mit Blick auf die geplante Kodifikation des Bürgerlichen Rechts (BGB) Gegenentwürfe erarbeitet und zukunftsweisende Vorschläge zur Verbesserung des Scheidungs-, Sorge- oder Güterrechts formuliert (7. Kapitel, S. 189). Von diesen Vorschlägen sind aber, wenn überhaupt, nur wenige verwirklicht worden. Erst in der Zeit zwischen
[<<32]
1914 und 1933 haben skandinavische Länder versucht, sie durch Gesetzgebung umzusetzen (8. Kapitel, S. 217). Diese Gesetzgebung hat in vielen Ländern Wirkungen entfaltet und insbesondere auch auf die in der Weimarer Republik geführte Reformdiskussion Einfluss genommen. Den Vorhaben der Weimarer Republik war zunächst allerdings kein Erfolg beschieden. Nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten sie aber die Grundlage bei der Konzeption eines egalitären Ehe- und Familienrechts. Gegenwärtig stellt sich überall in Europa für das Familienrecht die Aufgabe, geschlechtergerechte Ausgleichssysteme zu entwickeln, die nicht an den Status, sondern an die „gelebte“ Aufgabenteilung der Partner oder Eheleute anknüpfen. Dieser Befund führt zur Frage, wo wir heute stehen, die im 9. Kapitel, S. 241 erörtert wird.
Gesellschaftlicher Wandel kann für das Recht nicht ohne Folgen bleiben. Drei ‚Epochen‘ oder ‚Modelle‘ wären innerhalb der Familienrechtsgeschichte zu unterscheiden: An erster Stelle steht das „patriarchalische Ernährermodell“, auf dem auch das Familienrecht des BGB in der Fassung vom 1. Januar 1900 noch beruht. Daran schließt sich im 20. Jahrhundert das formal „egalitäre Ernährermodell“, welches nach der Wende zum 21. Jahrhundert durch neue materiale Wertvorstellungen überholt zu werden scheint. Der Hauptunterschied dieser drei ‚Modelle‘ liegt darin, dass sie verschiedene Lösungen für das Problem geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung vorsehen.
Nach dem „patriarchalischen Ernährermodell “ ist die Frau zur Haushaltsführung bzw. zur Pflege und Erziehung der Kinder verpflichtet. Sie muss diese Leistungen unentgeltlich erbringen, was die Verfasser des BGB mit dem Argument rechtfertigen, dass der Mann die „ehelichen Lasten allein zu tragen“ habe ( 7.4.2, S. 211). Die Arbeitsteilung der Geschlechter steht also unter der Prämisse, dass der außerhäuslich erwerbstätige Mann zur Leistung von Barunterhalt und die Frau zur unentgeltlichen Erbringung „häuslicher Dienste“ verpflichtet ist. Diese Art von ‚Austausch‘ oder ‚Reziprozität‘ ist freilich nicht egalitär, sondern hierarchisch
[<<33]
strukturiert. Es herrscht der Grundsatz ‚wer zahlt, befiehlt‘: Wer die „ehelichen Lasten“ trägt, gilt als „Haupt der Familie“, dem zugleich die Entscheidungsgewalt zusteht. Während also das patriarchalische Ernährermodell auf der Idee eines ‚Austauschs‘ von ‚Versorgung gegen Gehorsam‘ beruht, erblicken die Anhänger eines egalitären Ehe- und Familienrechts nicht nur im Barunterhalt, sondern auch in den „häuslichen Diensten“ eine geldwerte Leistung. Sie meinen, dass Hausarbeit und außerhäusliche Erwerbstätigkeit als rechtlich gleichwertig behandelt und die Begriffe von „Arbeit“ und „Unterhalt“ auch auf die Tätigkeit des nicht erwerbstätigen Ehegatten ausgedehnt werden müssen. Mit dem Gleichberechtigungsgesetz von 1958 hat dieses ‚Modell‘ im BGB einen ersten Niederschlag gefunden: Die ehemännlichen Entscheidungsbefugnisse wurden abgeschafft, Erwerbs- und Hausarbeit gleichgestellt und das Zugewinnausgleichsrecht eingeführt. Die große Reform des Ehe- und Familienrechts von 1977 hat dann die Pflicht des erwerbstätigen Ehepartners zur Leistung von nachehelichem Unterhalt erheblich ausgeweitet. In Verbindung mit der Einführung des Versorgungsausgleichs führte dies zu einer bislang nicht gekannten Absicherung der nicht erwerbstätigen Ehefrau. Eine solche „asymmetrische“ Interpretation formaler Gleichstellung schien geboten, um auch unter gewandelten Bedingungen am Ernährermodell festhalten zu können.
Trotz aller Unterschiede beruhen „patriarchalisches“ und „egalitäres“ Ernährermodell auf einer Reihe gemeinsamer Merkmale. Dazu gehören die strikte Trennung von häuslicher und außerhäuslicher Tätigkeit oder die Ableitung der vermögensrechtlichen Stellung der Frau aus der Erwerbstätigkeit des Mannes. Während aber das „patriarchalische“ Ernährermodell mit der Idee verbunden ist, dass die Auflösung einer Ehe nur unter engen rechtlichen Voraussetzungen zulässig ist, strebt das „egalitäre“ Ernährermodell nach einer Erleichterung der Scheidung. Auf den sich in den 1970er Jahren abzeichnenden Trend der Zunahme von Scheidungen reagierte das „egalitäre“ Ernährermodell mit einem ungebremsten Ausbau von Schutzmechanismen zugunsten des in der Ehe nicht erwerbstätigen Ehegatten. Mit Konzepten wie „lebenslange nacheheliche Solidarität“ oder „Lebensstandardgarantie“ glaubten seine Anhänger selbst nach Abschaffung des Verschuldensprinzips noch daran
[<<34]
festhalten zu können, dass die Ehe eine dem eigenen Erwerbseinkommen vergleichbare Versorgung des nicht erwerbstätigen Ehegatten biete. Auch das „egalitäre“ Ernährermodell beruht auf einem Verständnis der Ehe, das den Akzent nicht auf Individualität, sondern auf Status und damit auf lebenslange Versorgung und letztlich Abhängigkeit legt. Durch Begriffe wie „nacheheliche Solidarität“ oder „Lebensstandardgarantie“ werden die familienrechtlichen Ausgleichssysteme geradezu darauf programmiert, auch solches Vermögen zu vergemeinschaften, das „eheneutral“, d.h. nicht auf Grundlage gemeinsamen Wirtschaftens erworben wurde.
Die fortschreitende Individualisierung und Pluralisierung der Lebensverhältnisse hat dazu geführt, dass gegenwärtig vermehrt über einen Wandel von Leitbildern und die Auflösung geschlechtsspezifischer Rollenstereotypen diskutiert wird, wie sie nicht nur im „patriarchalischen“, sondern auch in den verschiedenen Varianten eines „egalitären“ Ernährermodells zum Ausdruck kommen. Heute müssen Paare auf Fragen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die früher durch Rollenbilder, im Recht verankerte Eheverständnisse oder Status gelöst wurden, häufig selbst eine Antwort finden. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine dritte Perspektive an Interesse, die im Zeichen eines Aushandelns der Lebensplanung steht. Der Hauptunterschied dieses Ansatzes zum überkommenen Familienernährermodell besteht darin, dass die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern nicht mehr als dem Recht vorgegeben, sondern als Folge einer gemeinsamen Entscheidung im Lebenslauf der Paare erscheint. Mit der Ehe- bzw. Partnerschaftsbedingtheit als leitendem Prinzip einer geschlechtergerechten Vermögens- und Haftungsteilhabe rückt für die familienrechtlichen Ausgleichssysteme die in der Ehe gelebte Aufgabenteilung – die im Einzelfall begründete Verantwortungskooperation – ins Zentrum des Interesses. Sie bildet nun den wichtigsten Anknüpfungspunkt für eine geschlechtergerechte Aufteilung der während der Dauer der Ehe bzw. Partnerschaft erzielten Vermögensvorteile und für die Bestimmung der wegen der Ehe bzw. Partnerschaft einseitig erlittenen Nachteile.
Wer den Fokus auf das Individuum und seine Entwicklung im Zeitverlauf legt, wird die Verantwortungskreise anders ziehen als diejenigen, die an Status und lebenslange Versorgung anknüpfen. Größere
Читать дальше