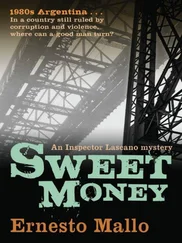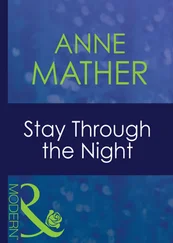Impressum
Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.deCopyright © 2014 Ernst Meder ISBN: 978-3-7375-2637-1
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Buch darf nicht – auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung kopiert werden.
von
Ernst Meder
Für Svenja Tabea
Seit Stunden stand er vor dem Gebäude, betrachtete jede Person, die das Haus verließ oder es betrat. Die Gesichter, die er sah, kamen ihm nur teilweise bekannt vor, eine Vielzahl der Mieter, kannte er von gelegentlichen Treffen zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Er wartete auf eine bestimmte Person, von der er mit Sicherheit wusste, dass diese noch immer in dem Gebäude wohnte. Woher er die Gewissheit nahm, diese Person war der Eigentümer dieses Gebäudes. Auch wenn diese Person, wie er vor kurzem erfahren hatte, auf ziemlich dubiose Weise in dessen Besitz gelangt war.
Lange hatte er überlegt, ob er es wagen sollte, aber er wollte von ihm erfragen, weshalb er mehr als vier Monate unschuldig im Gefängnis hatte zubringen müssen. Weshalb dieser alte Mann etwas so falsch dargestellt hatte, dass er die letzten einhunderteinundvierzig Tage in einem Untersuchungsgefängnis zubringen musste. Warum hatte er bei seiner Aussage nichts von dem Überfall auf Elisabeth Schlüter erzählt, der alten Dame, die in der Wohnung neben ihm wohnte. Dass sie zugleich seine Vermieterin war, erwies sich im Nachhinein als Segen, da er während seines Gefängnisaufenthaltes keine Miete zahlen konnte. Auf all diese Fragen, so hoffte er, würde er heute eine Antwort erhalten.
Mit einem freudlosen Lächeln dachte er an die Zeit zurück, als er Elisabeth Schlüter zum ersten Mal traf, als er sie kennenlernte. Es war im Sommer des vorigen Jahres als er, auf der Suche nach einer Wohnung auf das Inserat in der Wochenendausgabe einer Berliner Zeitung stieß. Kleine Wohnung wartet auf Studierenden, der zugleich ein angenehmer Nachbar ist, so der Inhalt dieses Inserates.
Anrufen kann nicht schaden, dachte er noch, als er sich die Wohnungssituation für Studenten vor Augen führte. Die Bestätigung seiner Immatrikulation an der Technischen Universität lag inzwischen vor, nun war er auf der Suche nach einer günstigen Unterkunft. Inzwischen war er einer Panik nahe, da alle bisherigen Versuche, wenigstens eine Bleibe für das Wintersemester zu finden, im Sande verlaufen waren. Seine Hoffnung war, wenn er vorläufig ein Zimmer in einer WG fände, könnte er während des laufenden Studiensemesters in Ruhe eine Wohnung suchen.
Sie musste das Vibrieren in seiner Stimme vernommen haben, welches die Angst erzeugt, denn sie lud ihn noch am gleichen Tag zu einer Besichtigung der Wohnung ein. Natürlich wollte sie ihn bei dieser Gelegenheit einer Prüfung unterziehen, ob er würdig war, ihr neuer Nachbar zu sein.
Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, so aufgeregt stand er vor dem klassizistischen Gebäude, in dem er sich in der zweiten Etage melden sollte.
Er war natürlich viel zu früh angekommen, sodass er durch die Gegend geschlendert war. Er wollte die Umgebung sehen, wollte fühlen, wie es sich anfühlte, wenn er in dieser Umgebung wohnen würde. Vor einem Mahnmal blieb er stehen, blickte auf den Eisenbahnwaggon, der auf einer freien Fläche stand. Interessiert war er zur Rückseite des Waggons gegangen, wo er auf eine Rampe blickte, auf der sich eine Marmorskulptur befand. Erst nach längerem Hinsehen erkannte er, was diese Skulptur darstellen sollte. Es waren zusammengeschnürte Menschen, die über die Rampe in den Waggon getrieben wurden. Sofort erschien dieses Bild vor seinem inneren Auge, ein Bild, wie er es in einer Fernsehsendung oder einem Film gesehen hatte, er konnte sich nicht mehr genau erinnern. Menschen, die von Menschen in Uniform gewaltsam und unter Schlägen in einen Waggon getrieben wurden. Bei den Fällen, wo man auf Gewalt verzichtete, unterlagen die Menschen jüdischen Glaubens der falschen Annahme, die Deportationen erfolgten nur in Sammellager, wo sie Zwangsarbeit verrichten sollten.
Vorsichtig betrat er die Rampe, er wollte auch sehen, was sich im Inneren verbarg. Er musste sich bücken, um nach innen zu gelangen, wo ihn steinerne Figuren empfingen. Es wirkte beklemmend, so zwischen den steinernen Figuren zu stehen und das Licht durch die offenen Stirnseiten zu sehen.
Es war ein bedrückendes Gefühl, trotzdem schloss er die Augen, dabei versuchte sich vorzustellen, was die Menschen damals empfunden haben mochten. Zusammengepfercht hatte man Männer, Frauen und Kinder tagelang in diesen verschlossenen Waggons transportiert, ohne dass diese die Umgebung sehen konnten.
Zuerst ganz leise dann langsam lauter werdend drang ein Gemurmel an sein Ohr. Er hörte das Flüstern von Stimmen, dazwischen das Weinen kleiner Kinder, sie alle litten unter der drückenden Hitze oder schneidenden Kälte. Aus einer anderen Ecke des Waggons das Gebet von mehreren Personen, die um ein gerade verstorbenes Familienmitglied trauerten. Plötzlich glaubte er sich gefangen in einer anderen, einer fremden Realität, die sich in seinem Unterbewusstsein festsetzte. Ein stechender Geruch, der sich in dem Waggon breitmachte, erinnerte ihn daran, dass diese Menschen gezwungen waren ihre Notdurft in Eimern zu verrichten.
Mühsam versuchte er sich von diesen Bildern aus der Vergangenheit zu befreien, riss gewaltsam seine Augen auf. Alles war unverändert, ungläubig rieb es sich über das Gesicht, dann bemerkte er die Feuchtigkeit in seinem Gesicht, die Tränen verursachen.
Er fühlte, wie sich Kälte in ihm ausbreitete, obwohl die Sonne schien und die Temperatur an diesem Tag achtundzwanzig Grad betrug. Auf dem Weg nach draußen sah er die im Boden eingelassenen Metallplatten die, wie er später herausfand, die nicht mehr existierenden Synagogen abbildeten. Noch von dem Eindruck gefangen starrte er auf eine hohe Eisenplatte, in die die einzelnen Transporte in die Konzentrationslager eingestanzt waren. Erst zu einem späteren Zeitpunkt erfuhr er weitere Einzelheiten, die das Düstere des Denkmals erklären sollte.
Noch immer beeindruckt von der Dimension der Verbrechen an die er bei der Besichtigung des Mahnmals erinnert wurde stand er nun vor dem Hauseingang. Vorsichtig drückte er auf den Klingelknopf, als ob er davor zurückscheute, jetzt zu stören. Das unmittelbare Summen des Türöffners ließ vermuten, dass Frau Schlüter ihn schon erwartete. Ohne den Aufzug zu beachten, trat er in das Treppenhaus, um zur zweiten Etage zu gehen. Er hoffte bis dahin, dieses Gefühl der Beklommenheit wieder besser kontrollieren zu können, er wollte seine Gefühle nicht so offen zur Schau stellen.
An der Eingangstür erwartete ihn eine Frau, die ihn an eine jüngere Version von Loki Schmidt erinnerte, im Gegensatz zu der Frau des ehemaligen Bundeskanzlers waren ihre kurzen Haare in einem melierten Grau. Ihre Augen blickten neugierig, wie er nervös die letzten Stufen bewältigte, dabei wurde ein Lächeln sichtbar, welches bis zu ihren Augen reichte.
›Sie sind Jo Berger‹, fragte sie mit einer tiefen Stimme, die ihn überraschte.
›Frau Schlüter, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Eigentlich heiße ich Johann, aber meine Freunde nennen mich Jo. Jetzt hoffe ich, dass Sie nicht zu viele Einwände an mir finden‹. Sein verlegenes Lächeln, noch geprägt von dem vorherigen Eindruck, wirkte etwas bedrückt.
»Jetzt kommen Sie erst mal herein, wir werden uns schon vertragen«, damit trat sie zur Seite um ihn vorbei zu lassen, dann schloss sie bedächtig die Tür. »Setzen Sie sich ruhig auf das Sofa, ich habe uns Kaffee zubereitet«. »Sie haben doch nichts dagegen, dass ich mit ihrem altmodischen Vornamen vorlieb nehme, und werten dies nicht als Ablehnung ihrer Person.«
Als er ihren fragenden Blick mit einem Nicken bestätigte, nahm sie eine Tasse vom Tisch und goss mit ruhiger Hand den Kaffee in die Tasse. »Zucker und Milch nehmen Sie sich bitte selbst«.
Читать дальше