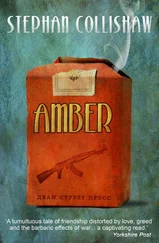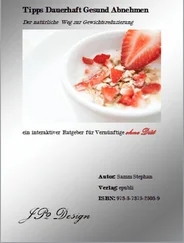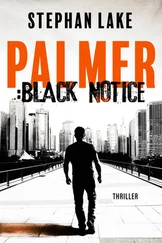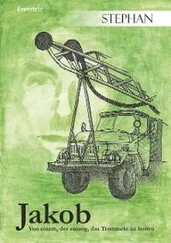Für Dorothee Schmidt und Martin Brendebach,
die von Anfang an mit marschiert sind.
Trotz allem, denkt sie: Der Garten ist ein Traum. Von Osten her brechen Sonnenstrahlen durch die Ligusterhecke, legen sich waagerecht über aufblühende Beete und nehmen die Stämme von Birken und Kastanien in Besitz. Eine Stille aus Vogelgezwitscher und Insektengesumm füllt die schattenkühle Luft des beginnenden Tages und lässt alle anderen Geräusche verblassen: Verkehr auf der Hauptstraße und Schülergeschrei unten im Ort. Ein Netz aus weißem Tau bedeckt die Wiese, löst sich langsam auf, wo Sonnentupfer durch das Blattwerk fallen, und beteiligt sich am Wechselspiel von Licht und Schatten. Schmetterlinge umgarnen den Flieder in seinem blauen Tongefäß.
Im Morgenmantel steht Kerstin auf der Terrasse und drückt sich die Zeigefingerspitzen gegen die Schläfen. Ein Auto kommt vom Maibaumplatz den Rehsteig herab, passiert das Haus und biegt links ab, talwärts und fast ohne Gas, wie in nachbarschaftlicher Sorge um die morgendliche Ruhe. Dann kehren Stille und Vogelgezwitscher zurück, als wären sie zwischen Hecken und Bäumen in Deckung gegangen.
Hinter ihr im Haus rauscht die Wasserleitung.
Nach dem Frühstück und der ersten Tasse Kaffee fühlt sie sich beinahe gut, beinahe dem Tag gewachsen, obwohl sie wieder schlecht geschlafen hat und erst die Gartenarbeit am Nachmittag diesen Anflug von Kopfschmerzen vertreiben wird: ein Druckgefühl dicht unter der Schädeldecke. Ohne Zypiklon entlässt ihr Schlaf sie schon um vier Uhr morgens in die fahle Dämmerung eines weiteren Tages, aber jetzt ist es neun, und Kerstin macht einen Schritt nach vorne, spürt die Wärme der Sonne angenehm an den nackten Fesseln. Jedes Jahr im Frühling gibt es einen Tag, an dem sie das Gefühl hat, der nächste Sommer ziehe wie ein großes Versprechen herauf, reite ihr von den grünglänzenden Bergrücken am Horizont entgegen, und obwohl sie es besser weiß, lässt sie sich verzaubern von seinem Anblick und ist machtlos gegen den Glauben, dass in diesem Sommer alles besser werden wird.
— Und warum nicht? würde Anita sagen. Jedenfalls besser als Selbstmitleid.
— Stattdessen Selbstbetrug.
— Du müsstest nur auf mich hören und endlich wegziehen aus diesem Kaff.
Kerstin lässt die Hände sinken und schüttelt den Kopf. Vielleicht ist es die schiere Länge des Hinterländer Winters, die sie gegenüber dem Sommer so leichtgläubig macht. Dieses Jahr hat bis in den März hinein Schnee gelegen, und in ihrem Rücken zieht sich immer noch ein feuchter Streifen entlang des Winkels von Terrassenboden und Hauswand und verbreitet den Geruch alter Zeitungen. Und übrigens kann sie nicht wegziehen. Erstens weil sie nicht weiß wohin, zweitens wegen Daniel, drittens wegen ihrer Mutter, und viertens …
Sie lässt den Blick durch den Garten schweifen und bleibt an der großen Hecke hängen. Meinrichs haben ihre Seite trimmen lassen vor einer Woche und nicht versäumt, ›der Frau Nachbarin‹ anzubieten, die fröhlichen Helfer aus der Behindertenwerkstätte auch auf die andere Seite zu schicken. Der ›Frau Nachbarin‹ — so als wären sie sich nach fast sieben Jahren des Namens noch immer nicht sicher, als gäbe es zum Beispiel kein Schild neben der Tür, an die Frau Meinrich eigens gekommen ist, um das Angebot zu überbringen. Mit diesem vorwurfsvollen Gesichtsausdruck, den Kerstin erst noch lernen muss als eine bestimmte, dem Alter eigene Form der Fürsorglichkeit zu verstehen. (Viertens schließlich: Was geht das Anita an?) Dankend hat sie abgelehnt und auf ihren Sohn verwiesen, der mit seinen sechzehn Jahren wohl in der Lage sei, eine Hecke zu stutzen. Sie Glückliche! Frau Meinrich — mürrisch, dauergewellt und zu aufdringlich parfümiert — hat sich auf ihren Stock gestützt und nicht näher erläutert, worin sie das Glück ihrer Nachbarin sieht. Dass seine steile politische Karriere Meinrich Junior bis ins ferne Wiesbaden verschlagen hat, geht kaum als Unglück durch, und deshalb weiß Kerstin auch im Rückblick nicht zu entscheiden, wie viel Aufrichtigkeit in Frau Meinrichs Bemerkung gelegen hat und was gegebenenfalls das andere gewesen sein mochte.
Durch die Hecke hindurch sieht sie eine schemenhafte Bewegung im Garten ihrer Nachbarn. Erst neulich wieder war ein Bild im Bergenstädter Boten , auf dem Klaus Meinrich die Aktentasche des hessischen Ministerpräsidenten vor sich hertrug, mit messdienerhaftem Ernst in der Miene, während der Ministerpräsident selbst nebenher schritt und sein übliches, routiniertes Gesicht machte. Immer noch trägt der Junior den Bürstenhaarschnitt des Vaters, und soweit ein Schwarzweißbild darüber Aufschluss gibt, scheinen sich auch die Blutdruckwerte einander anzunähern. Tipptopp ist eins der Lieblingswörter des Alten, egal ob es um Frisuren, Hecken oder Politiker geht, und Daniel kann ihn imitieren, wie er dabei eine Miene macht, als zitiere er griechische Klassiker im Original. Wie schon Platon wusste: Hauptsache tipptopp.
Im Innern des Hauses wird die Badezimmertür geöffnet. Der Gedanke an Daniel, den sie gerade hat festhalten wollen, entgleitet ihr wieder. Das Quietschen orthopädischer Schuhe setzt einen Moment aus und dann wieder ein, und Kerstin fühlt ihre Rückenmuskeln steif werden, als hätte sie eine falsche Bewegung gemacht. Langsam durchquert ihre Mutter die Diele. Den Stock hat sie sich unter den Arm geklemmt, so dass die Spitze beim Gehen gegen die Wand tippt, denn in den Händen trägt Liese Werner ihren Zahnputzbecher, der gegen alles Zureden seinen festen Platz auf dem Nachttisch neben dem Bett hat. Sonst stehlen ihn ›die Männer‹. Auf dem Esstisch steht das Frühstücksgeschirr, und Kerstin sieht im Geist die Stockspitze eine weitere Kaffeekanne über die Kante schubsen, während ihr Körper sich weiter versteift, je länger das Geräusch zerspringenden Glases ausbleibt. Dann verstummt das Quietschen der Schuhe, Kühle fließt von der Terrasse ab, und in Kerstins Rücken stößt ein Blick, nein, stößt nicht — stupst, berührt sie mit der sanften, kindergleichen Hilflosigkeit des Alters. Eigentlich, fällt ihr auf, hat die Hecke noch kaum ausgeschlagen; sie wird also Schwierigkeiten bekommen, ihrem scharfsinnigen Sohn zu erklären, warum sie trotzdem geschnitten werden muss.
«Muss ich denn dann meine Medizin noch nehmen?«
Vogelgezwitscher füllt ihren Garten. Blätter hängen reglos in der Morgenluft. Herzlichen Glückwunsch, Kerstin, denkt sie. Dann schließt sie die Augen.
«Hast du schon, Mutter. Gleich nach dem Frühstück.«
«So?«
«Ja.«
«Da waren doch wieder welche im Haus heute Nacht.«
«Nein, niemand.«
«In der Küche. Ich hab sie gehört, ja.«
In der Küche hab ich dich gehört, denkt Kerstin. Um halb zwei. Unerwartet schwer scheint die Sonne auf ihre Lider und verursacht einen Eindruck von formlosem Rot, das weder nah noch fern, noch sonst wie bestimmt ist, nur eine Farbe, die vor ihrem Auge schwimmt und sich warm anfühlt. Angenehm warm.
«Zwölf Grad waren’s am Morgen. «Mehrmals am Tag kontrolliert ihre Mutter das Thermometer auf der Fensterbank, und Dr. Petermann sagt, dass Demenzkranke häufig dieses auffällige Interesse am Wetter entwickeln. Für die Männer allerdings hat auch er keine Erklärung, außer der, die alles erklärt: das Alter.
«Ganze zwölf Grad«, wiederholt ihre Mutter.»Das wird noch was geben, ja.«
«Jetzt sind es mehr.«
«Bitte?«
«Jetzt ist es wär-mer.«
«Wird bald wieder, ja«, sagt ihre Mutter nach einer Pause, in der Kerstin ihrer eigenen Stimme nachgehorcht hat, der Anstrengung des lauten Sprechens in einzelnen Silben. Sie bekommt davon Falten um die Augen und Schmerzen hinter den Schläfen und bringt es sowieso nicht länger über sich, mit geschlossenen Augen den Hang hinabzusprechen. Langsam wendet sie den Kopf.
Читать дальше