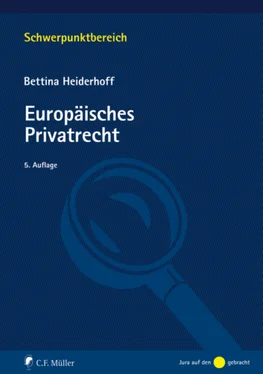71
Im Beispiel 4( Rn. 69) sieht sich S einer österreichischen Gewerberegelung ausgesetzt, die den Vertrieb von Schmuck im Wege von Haustürgeschäften verbietet. Dieses Verbot ging über die damalige Haustür-RL, die lediglich ein Widerrufsrecht für solche Geschäfte vorsah, weit hinaus. Die Regelung macht es inländischen, aber eben auch ausländischen Händlern unmöglich, in Österreich Schmuck an der Haustür zu verkaufen. Daher fragt sich, ob sie gegen die Grundfreiheiten verstößt. Insbesondere könnte die Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) beeinträchtigt sein. Dazu müssten zunächst Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten durch das Verbot mehr berührt sein als inländische Erzeugnisse. Im Fall A-Punkt konnte der EuGH dies aus dem Sachverhalt nicht entnehmen.[137] Leicht lässt sich der Fall aber entsprechend entwickeln. Wenn beispielsweise in Österreich gar kein Silberschmuck hergestellt wird, während gerade der Haustürverkauf solcher Waren aus den Nachbarländern ganz üblich ist, muss eine Verletzung des Art. 34 AEUV im Sinne einer „Maßnahme gleicher Wirkung“ bejaht werden.
72
Einige Richtlinien enthalten weiterhin eine Mindeststandardklausel (näher schon Rn. 21). Sie sehen also das Festhalten der Mitgliedstaaten an einem höheren Schutzstandard grundsätzlich vor. Fraglich ist aber, was gilt, wenn durch diesen höheren Schutzstandard zugleich die Grundfreiheiten berührtwerden. Wenigstens wenn ausländische Unternehmen von einem solchen Verbot verstärkt betroffen sind, muss eine Beeinträchtigung der Grundfreiheiten zunächst bejaht werden.
In der Lehre ist versucht worden, für diesen Konflikt zwischen Mindeststandardgebot und Grundfreiheiten eine grundsätzliche, dogmatische Lösung zu finden. Folgt man diesem Versuch, so scheint der Kern in der grundlegenden Frage zu liegen, in welchem Verhältnis das Subsidiaritätsprinzip (mit dem daraus abgeleiteten Mindeststandardgrundsatz – zu dieser Beziehung schon Rn. 20) zu den Grundfreiheiten steht. Was hat Vorrang: Die Grundfreiheiten oder das in den Mindeststandardklauseln verkörperte Subsidiaritätsprinzip? Die Frage ist umstritten.[138] Im Ergebnis ist sie wahrscheinlich fruchtlos.
Denn die Antwort auf die konkrete Frage nach der Ausschöpfung der Mindeststandardklausel steht ohnehin fest. Es ist sicher, dass die Mitgliedstaaten die Grundfreiheiten auch dann nicht ungerechtfertigt einschränken dürfen, wenn ihnen in einer Maßnahme der Rechtsangleichung ausdrücklich die Befugnis zu strengerem nationalen Recht eingeräumtwird. Das spricht auch der EuGH immer wieder klar aus: Die Mitgliedstaaten müssen bei der Ausschöpfung von Mindeststandardklauseln die Grundfreiheiten wahren.[139]
b) Rechtfertigungsgründe bei einem Grundfreiheitenverstoß durch Ausschöpfung der in den Mindeststandardklauseln gewährten Regelungsbefugnis
73
Damit bleibt die Frage, ob eine Beeinträchtigung der Grundfreiheiten, die durch eine die Mindeststandardklausel ausnutzende und gegenüber der Richtlinie strengere nationale Regelung erfolgt, zulässig bzw. wenigstens gerechtfertigt sein kann.
Nach der hier vertretenen Ansicht (soeben Rn. 66 ff.) sollten Beschränkungen der Grundfreiheiten durch nationales Privatrecht grundsätzlich zulässig sein. Begründet wurde dies damit, dass das Privatrecht in seiner Einheit den Handel überhaupt erst ermöglicht, und dass einzelne kleine Beeinträchtigungen der Grundfreiheiten, die durch ein intaktes Privatrecht verursacht werden können, demgegenüber hingenommen werden müssen. Für solche privatrechtlichen Normen, die über den Standard von Richtlinien hinausgehen, kann das aber nicht gelten. Denn dort bestehen ja eigene europäische Regelungen, so dass die nationalen Regelungen nicht mehr unentbehrlich sind.
74
Somit muss gefragt werden, ob in diesen Fällen wenigstens die oben beschriebene Rechtfertigung nach der Cassis-Formelgreift. Ihrem Wortlaut nach greift auch die Cassis-Formel hier nicht ein. Denn sie beginnt mit der Einschränkung: „ In Ermangelung einer gemeinschaftlichen Regelung “. Diese „Ermangelung“ einer gemeinschaftlichen Regelung kann bei Vorliegen einer Richtlinie streng genommen nicht mehr bejaht werden. Bei über Richtlinien hinausgehenden Normen kann nicht davon gesprochen werden, dass diese Normen des Privatrechts überhaupt erst die Grundlage des grenzüberschreitenden Handelsverkehrs darstellen. Im Gegenteil: Nationale Normen, die über die Vorgaben der Richtlinie hinausgehen, sind für eine funktionsfähige Rechtsordnung verzichtbar.
75
Dennoch ist die Rechtsprechung des EuGH hier großzügig. Danach schließt nicht jede, sondern nur eine als abschließend konzipierte europäische Regelung die Rechtfertigung nach der Cassis-Formel aus.[140] Soweit eine abschließende Regelung zu verneinen war, hat der EuGH geprüft, ob die Beschränkung der Grundfreiheiten durch das strengere nationale Recht gerechtfertigt war.[141]
Der EuGH hält gerade auch den Verbraucherschutz selbst dann grundsätzlich noch für einen ausreichenden Rechtfertigungsgrund, wenn bereits die Richtlinie auf den Verbraucherschutz abzielt.[142] Dabei prüft er wie immer, ob die Maßnahme erforderlich und im engen Sinne verhältnismäßig ist, was er ebenfalls nicht schon wegen des Vorliegens der Richtlinie verneint.[143] Die Vorgehensweise des EuGH lässt sich gut an dem Fall Gysbrechts ablesen.[144] Dort hatte ein belgischer Onlinehändler von ausländischen Kunden bei der Warenbestellung die Angabe der Kreditkartennummer verlangt. Das belgische Recht verbot es, vor Ablauf der Widerrufsfrist irgendwelche Zahlungen zu verlangen. Das erstinstanzliche belgische Strafgericht meinte, gegen diese Vorgabe habe der Händler schon dadurch verstoßen, dass er die Kreditkartennummer verlangt habe. Das zweitinstanzliche Gericht legte dem EuGH die Fragen vor, ob das belgische Recht das Zahlungsverlangen vor Ablauf der Widerrufsfrist verbieten dürfe, und ob es auch verbieten dürfe, die Kreditkartennummer schon bei der Bestellung zu verlangen. Der EuGH folgte der Argumentation Belgiens und gestattete die weit über die Richtlinie hinausgehende Schutzvorschrift, dergemäß Bezahlung erst nach Ablauf der Widerrufsfrist verlangt werden durfte. Er meinte jedoch, es sei unverhältnismäßig und unzulässig, dem Unternehmer zu verbieten, die Nummer der Kreditkarte des Verbrauchers zu verlangen. Denn dies sei zum Schutz nicht von weiterem Nutzen, weil es dem Unternehmer bis zur Fälligkeit ohnehin verboten sei, diese Nummer zu benutzen. Dieser differenzierenden Ansicht des EuGH sollte gefolgt werden. Sie ist handhabbar und hat zugleich den Vorteil einer gewissen Flexibilität.
76
Dabei darf generell angenommen werden, dass die Union mit den Mindeststandardklauseln zu erkennen gibt, dass die Richtlinien kein abschließendes Verbraucherschutzkonzeptbilden. Für über den Standard der Richtlinien hinausgehendes nationales Recht, welches die Grundfreiheiten beschränkt, kommt eine Rechtfertigung nach der Cassis-Formel in Betracht.
77
Im Beispiel 4( Rn. 69) ist daher – wenn eine Maßnahme gleicher Wirkung bejaht wurde – zu prüfen, ob der Verbraucherschutz einen hinreichenden Rechtfertigungsgrund für das Verkaufsverbot darstellt. Zugunsten des Verbrauchers muss hier berücksichtigt werden, dass bei einem Schmuckverkauf an der Haustür zusätzliche Informationsdefizite des Verbrauchers insbesondere in Hinblick auf die Echtheit und den Wert der Schmuckstücke bestehen können.[145] Auch ist der Verkaufsanreiz vielleicht besonders groß, während der Nutzen der Ware gering ist. Der EuGH überließ die Prüfung des Art. 36 AEUV, der hier einschlägig ist, den österreichischen Gerichten.
§ 3 Europarechtliche Grundlagen für die Privatrechtssetzung› C. Grundfreiheiten, Diskriminierungsverbot, Unionsbürgerschaft und Privatrecht › V. Drittwirkung von EU-Grundrechten, Grundfreiheiten und Diskriminierungsverboten im Privatrecht
Читать дальше