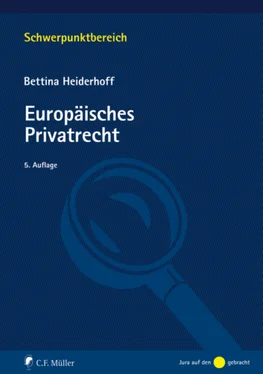57
Gerade angesichts der weiterhin undeutlichen Rechtsprechung des EuGH besteht eine seit Jahren andauernde Diskussion über die Wirkung der Grundfreiheiten auf das Privatrecht. Nach allgemeiner Ansicht kann die Kontrolle des Privatrechts am Maßstab der Grundfreiheiten jedenfalls nicht unbegrenztsein. Die noch nicht endgültig beantwortete Frage besteht darin, wie diese eingeschränkte Wirkung der Grundfreiheiten begründet werden kann. Im Folgenden werden einige der wichtigsten in der Wissenschaft diskutierten Eingrenzungsversuche vorgestellt.
b) Eingrenzung der Wirkung der Grundfreiheiten auf grenzüberschreitende Sachverhalte
58
Bei der Aufregung um das Verhältnis von nationalem Privatrecht und Grundfreiheiten darf nicht übersehen werden, dass die Grundfreiheiten nur Binnenmarktsachverhalte erfassen. Sie greifen also nur in Fällen ein, bei denen Berührung zu mehreren Mitgliedstaatengegeben ist. Die viel häufigeren rein innerstaatlichen Sachverhalte werden von den Grundfreiheiten dagegen nicht berührt.[113]
Zu bedenken ist aber auf der anderen Seite, dass eine zivilrechtliche Norm, wenn der EuGH sie – in einem Sachverhalt mit Auslandsberührung – für grundfreiheitenwidrig erklärt hat, im Rechtsverkehr ohne Auslandsberührung nicht bedenkenlos weiter gelten kann. Es würde dadurch nämlich eine Ungleichbehandlung von nationalen und grenzüberschreitenden Verträgenerfolgen. Zwar besteht das Schlagwort, dass der EuGH bzw. das EU-Recht „die Inländerdiskriminierung“ dulde.[114] Es ist aber offenkundig, dass die Inländerdiskriminierung, wiewohl das EU-Recht zurzeit keine Mittel dagegen kennt, dem Binnenmarktgedanken nicht günstig ist. Zudem wird oftmals das nationale Recht und insbesondere Art. 3 Abs. 1 GG verletzt sein, so dass schon dies einer Weiteranwendung der Norm auf innerstaatliche Sachverhalte entgegenstünde.[115]
c) Eingrenzung der Wirkung der Grundfreiheiten auf zwingendes Recht
59
Vielfach wird vertreten, die Wirkung der Grundfreiheiten sei auf die zwingenden Normen des Privatrechts beschränkt.[116] Es wird gesagt, dass die Parteien dispositives Recht nach ihren eigenen Vorstellungen abbedingen könnten und dass deshalb eine Verletzung der Grundfreiheiten durch dispositives Recht nicht zu befürchten sei. Da die Sachverhalte, in welchen Grundfreiheiten verletzt werden können, stets Auslandsberührung haben, wird diese Ansicht oft noch erweitert: Der Grundfreiheitenkontrolle unterliege nur das Recht, welches die Parteien bei einer Rechtswahl nach Art. 3 Rom I-VO nicht abwählen könnten. Daher sei nur das nach Art. 9 Rom I-VO international zwingende Recht an den Grundfreiheiten zu messen.[117]
Diese Ansicht begegnet jedoch einigen Bedenken. Denn zwar ist es theoretisch richtig, dass durch eine Rechtswahl oder durch die Abbedingung einschränkender Normen die Beeinträchtigung der Grundfreiheiten vermieden werden kann. Faktisch aber steht die Möglichkeit der Rechtswahl und der Rechtsgestaltung durch Vertrag nur Wenigen offen.[118] Im Verbraucherschutzrecht sind nach Art. 6 Abs. 2 Rom I-VO ohnehin viele Regelungen zwingend und die Rechtswahl ist ausgeschlossen. Für den großen Bereich des Verbrauchervertragsrechts kann ein Verweis auf die Vertragsfreiheit also keine Entwarnung herbeiführen. Aber auch für Unternehmer ist die Möglichkeit der Gestaltung der Vertragsbedingungen und der Rechtswahl oft zu kostenintensiv (weil mit hohem Informationsaufwand verbunden) und zu schwer durchzusetzen (weil meist nur einer Partei nützlich), als dass sie eine Beeinträchtigung der Grundfreiheiten ausschließen könnte.
d) Eingrenzung der Wirkung der Grundfreiheiten durch Aufteilung des Privatrechts in Verkaufs- und Produktmodalitäten (Weiterentwicklung der Keck-Entscheidung)
60
Intensiv untersucht worden ist auch, ob es möglich ist, für das Privatrecht an die Keck-Rechtsprechung des EuGH (dazu soeben Rn. 55) anzuknüpfen, und die privatrechtlichen Normen in Verkaufsmodalitäten und Produktmodalitäten zu unterteilen.[119] Alle Normen, die Verkaufsmodalitäten sind, brauchen nämlich nach der Keck-Rechtsprechung nur daraufhin überprüft zu werden, ob sie diskriminierend wirken.
Wenn nun der Begriff „Produktmodalität“ so verstanden würde, dass er nur solche Normen erfasst, welche die Vermarktung bestimmter Produkte erschweren, dann wäre die weitaus überwiegende Zahl der Privatrechtsnormen in der Tat als Verkaufsmodalitäten einzuordnen. Denn die meisten privatrechtlichen Normen legen nur allgemeine Konditionen für den Verkauffest und verbieten nicht den Handel mit bestimmten Produkten. Auf all diese Normen wäre dann die Keck-Rechtsprechung anzuwenden und der Großteil des Privatrechts unterläge somit nur dem Diskriminierungsverbot.
Da diese Auffassung von der Aufteilung des Privatrechts in Verkaufsmodalitäten und Produktmodalitäten immer wieder vertreten wird, seien im Folgenden einige typische Beispiele dargestellt.
61
Da sich Produktmodalitäten wohl immer auf ein bestimmtes Produkt beziehen müssen, sind Normen, welche die Modalitäten eines Vertragsabschlusses regeln, fast nie Produktmodalitäten. Denn sie machen keine bestimmten Vorgaben für Produkte, sie können also in der Regel auch nicht den Handel mit bestimmten Produkten beschränken. Sie bestimmen nur in allgemeiner, nicht auf bestimmte Produkte ausgerichteter Hinsicht, auf welche Weise Verträge abzuschließen und durchzuführen sind.
Einige wenige privatrechtliche Normen haben aber doch zur Folge, dass bestimmte Produkte überhaupt nicht verkauft werden dürfen. Vorstellbar ist die Einordnung als produktbezogen in Deutschland zunächst bei §§ 134, 138 BGB. Diese Normen schließen Verträge über gewisse Vertragsgegenstände völlig aus. Die relevanten Beispiele lassen sich vor allem im Bereich der Dienstleistungsfreiheit finden. So ist es bei den privaten Wettbüros. Den von Deutschland für das frühere Verbot vorgebrachten Rechtfertigungsgrund (Vorbeugung gegen Spielsucht) erkannten das BVerfG und der EuGH nicht an, da die staatliche Wettorganisation Oddset in großem Stil Werbung für Sportwetten gemacht hatte.[120] Als weitere in Europa relevante Beispiele sind der Prostitutionsvertrag und der Leihmuttervertrag genannt worden.[121] Verträge über diese Vertragsgegenstände sind in Deutschland nichtig, so dass also das jeweilige „Produkt“ bzw. der jeweilige „Dienst“ in Deutschland nicht (legal) vermarktet werden kann.
Aber auch andere Normen können bestimmte Produkte faktisch vom Markt drängen. Vor allem Remien , der versucht hat, die Differenzierung des Privatrechts in Produkt- und Verkaufsmodalitäten flächendeckend durchzuführen, hat dies aufgezeigt. So kann die zwingend vorgeschriebene Kündbarkeit des Darlehens mit veränderlichem Zinssatz nach § 489 Abs. 2 BGB zwar einerseits als Verkaufsmodalität verstanden werden. Sie lässt sich aber andererseits auch als Verbot des Produkts „Kredit mit variablem Zins aber fester Laufzeit“ deuten.[122]
62
Die Meinung, welche das Privatrecht in Produkt- und Verkaufsmodalitäten einteilen will, baut auf der Rechtsprechung des EuGH auf und systematisiert diese. Da die Entscheidungen des EuGH eine große Bindungswirkung entfalten (siehe zum Ausmaß dieser Wirkung näher unten Rn. 180), erscheint diese Ansicht zunächst vernünftig. Gegen sie spricht aber, dass die Unterscheidung von Verkaufs- und Produktmodalitäten sich für das Zivilrecht nicht sehr eignet. Schon angesichts der soeben aufgezeigten unterschiedlichen Betrachtungsmöglichkeiten verspricht die Aufteilung des Privatrechts in Verkaufs- und Produktmodalitäten keine befriedigende Klärung der Problematik.[123] Die Beispiele für unklare Fälle lassen sich zudem noch ausdehnen. So hat der EuGH selbst die im Rahmen der culpa in contrahendo entstehenden Nebenpflichten (im zu entscheidenden Falle eine Aufklärungspflicht) nicht als Produktmodalität und auch nicht als Verkaufsmodalität eingeordnet.[124] Überhaupt spricht es gegen die Übernahme des Modells der Verkaufs- und Produktmodalitäten, dass der EuGH selbst diese von ihm geprägte Unterscheidung bisher nicht auf zivilrechtliche Normen angewendet hat. Vor allem die zunächst vielleicht naheliegende Möglichkeit, das gesamte Zivilrecht als Verkaufsmodalität einzuordnen, erscheint durch die Rechtsprechung des EuGH versperrt. Somit bleibt es erforderlich, andere dogmatische Überlegungen zur Eingrenzung der Wirkung der Grundfreiheiten anzustellen.
Читать дальше