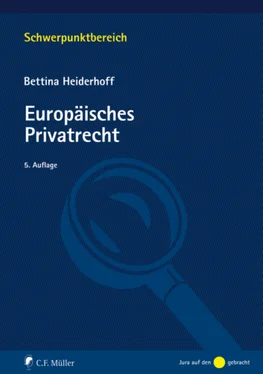Die vier Grundfreiheiten[78] bilden einen zentralen Kern des Binnenmarkts. Die in Art. 26 Abs. 2 AEUV genannten und im weiteren Vertragstext konkretisierten Freiheiten umfassen die Freiheit des Warenverkehrs gemäß Art. 28 f., 34 f. AEUV, die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs gemäß Art. 56 AEUV, die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 64 AEUV und die Freiheit des Personenverkehrs gemäß Art. 21 AEUV. Letztere enthält auch die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und die Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV).
2. Überblick zur Wirkungsweise der Grundfreiheiten
a) Deregulierungs- und Angleichungsgebot
47
Die vier Grundfreiheiten sollen im Binnenmarkt gewährleistet werden. Vereinfacht gesagt sollen also Waren, Dienstleistungen und Kapital innerhalb der EU frei gehandelt und transferiert werden sowie Personen sich frei bewegen können. Formal wird diese Freiheit auf unterschiedliche Art erreicht. Zunächst sind insbesondere alle behindernden Normen zu beseitigen . Soweit in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten Normen enthalten sind, welche die Grundfreiheiten beeinträchtigen, sind sie gemäß der allgemeinen Regel des Vorrangs des EU-Rechts unanwendbar. Ein Deutschland betreffendes bekanntes Beispiel war das Gesetz, welches den Verkauf von nicht nach dem Reinheitsgebot gebrautem Bier in Deutschland verbot. Das Verbot erschwerte den Import ausländischen Bieres und verstieß gegen Art. 34 AEUV (damals Art. 30 EWGV).[79] Diese Wirkung der Grundfreiheiten wird (in Anlehnung an die Grundrechtsdogmatik) als Abwehrrecht oder – mit einem allgemeiner auf den Abbau unterschiedlicher nationaler Regelungen gerichteten Begriff – als Deregulierungsgebot bezeichnet.[80]
Die Wirkung der Grundfreiheiten geht aber noch weiter. So können sie neue, die Grundfreiheiten erst gewährende Regelungen notwendig machen. Sie enthalten also in gewisser Weise auch ein Schutzrecht , oder konkreter, ein Angleichungsgebot .[81] Die Einzelheiten sind in diesem Bereich sehr streitig.[82]
b) Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot
48
Eine andere Einteilung der Wirkungsweise der Grundfreiheiten ist die Unterscheidung in das Diskriminierungs- und in das Beschränkungsverbot.
Die Grundfreiheiten verbieten jedenfalls jede diskriminierende Regelung. Als diskriminierend können Normen verstanden werden, die entweder direkt an die Nationalität oder den Aufenthaltsort anknüpfen oder die zwar auf andere Merkmale abstellen, indirekt aber doch zu einer (gewollten) Unterscheidung nach Nationalität oder Aufenthaltsort führen.
Aber auch Regelungen, die nicht diskriminierend sind, sondern sich nur faktisch negativ auf eine der Grundfreiheiten auswirken, werden in großem Umfang von den Grundfreiheiten erfasst. Die Grundfreiheiten sind also ein Maßstab, an dem sich auch solche Normen messen lassen müssen, die grundsätzlich auf Inlandssachverhalte bzw. unterschiedslos auf alle inländischen und grenzüberschreitenden Sachverhalte zugeschnitten sind. Ein Verstoß gegen die Grundfreiheiten liegt vor, wenn durch diese Normen der grenzüberschreitende Verkehr tatsächlich schlechter gestelltwird als der inländische.[83] Diese Wirkung der Grundfreiheiten auf das nicht diskriminierende nationale Recht wird als Beschränkungsverbot bezeichnet. Für die näheren Einzelheiten ist dabei zu beachten, dass die vier Grundfreiheiten – gerade in Hinblick auf die Beschränkungswirkung – nicht alle auf die gleiche Weise wirken.[84]
Durch das Verständnis der Grundfreiheiten als Beschränkungsverbote und die Erstreckung ihrer Wirkungen auf nicht diskriminierendes Recht kam die Frage auf, inwieweit die Grundfreiheiten auch das Privatrecht erfassen (dazu sogleich Rn. 52).
§ 3 Europarechtliche Grundlagen für die Privatrechtssetzung› C. Grundfreiheiten, Diskriminierungsverbot, Unionsbürgerschaft und Privatrecht › II. Allgemeines Diskriminierungsverbot
II. Allgemeines Diskriminierungsverbot
49
Das klassische binnenmarktbezogene Diskriminierungsverbot in Art. 18 AEUV bezieht sich nicht auf die bereits angesprochene Gleichbehandlung in Hinblick auf persönliche Merkmale wie Geschlecht, Rasse oder Alter, sondern allein auf die Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit. Die Grundfreiheiten sind lex specialis zu dem in Art. 18 AEUV enthaltenen allgemeinen Diskriminierungsverbot.[85] Das Diskriminierungsverbot wird also erst wichtig, wenn eine nationale Regelung eine Person aufgrund der Staatsangehörigkeit diskriminiert, ohne zugleich gegen eine der Grundfreiheiten zu verstoßen.
Der EuGH nimmt seit Langem an, dass Art. 18 AEUV Drittwirkung zwischen Privaten entfaltet.[86] Allerdings betrafen seine Entscheidungen immer Verbände (etwa im Bereich des Sports) oder Arbeitgeber.[87] Für individuellere private Vertragsbeziehungen wurde die Frage nie geklärt. Nun hat sie die praktische Bedeutung weitgehend verloren. Denn die Gleichbehandlungs-Richtlinien erfassen die typischen Fälle, in denen Private andere Private diskriminieren. Insbesondere die Gleichbehandlungs-RL (Rasse) enthält ausdifferenzierte Regelungen dazu, bei welchen privaten Rechtsgeschäften Diskriminierung sanktioniert wird und bei welchen sie hinzunehmen ist. Daneben ist eine unmittelbare Wirkung des Art. 18 AEUV, obwohl die Norm anders als die Richtlinie auf die Staatsangehörigkeit und nicht auf die Ethnie abstellt, kaum erforderlich. Vor allem würde sie die Gefahr bergen, dass die Abwägungen zwischen Freiheit und Gleichbehandlung, die hinter der Richtlinie stehen, unterlaufen würden.[88]
§ 3 Europarechtliche Grundlagen für die Privatrechtssetzung› C. Grundfreiheiten, Diskriminierungsverbot, Unionsbürgerschaft und Privatrecht › III. Unionsbürgerschaft
50
Der EuGH leitet aus der Unionsbürgerschaft als solcher Rechte ab, selbst wenn im konkreten Fall eine Diskriminierung oder eine Verletzung der Grundfreiheiten nicht begründet werden kann. Besonders deutlich ist dies in der Entscheidung Zambrano hervorgetreten.[89] Dort wurde die Ausweisung eines Drittstaatenangehörigen aus Belgien als Verstoß gegen Art. 20 AEUV gewertet. Dies geschah dem Wortlaut der Entscheidung nach, weil der Betroffene seinen beiden belgischen Kindern zum Unterhalt verpflichtet war und es ihm wohl nur in Belgien möglich war, ausreichend zu verdienen. Eigentlich meinte der EuGH aber wohl, den belgischen Kindern werde durch die Ausweisung des Elternteils selbst der Aufenthalt in Belgien entzogen, weil sie ihre Eltern begleiten müssten.[90] Damit sei ihnen der Kernbestand ihrer sich aus der Unionsbürgerschaft ergebenden Rechte verwehrt.
51
Versteht man das Unionsbürgerrecht so, dass es diesen „Kernbestand sich aus der Unionsbürgerschaft ergebenden Rechte“ sichert, so hat es potentiell eine sehr breite Wirkung. Für das Privatrecht ist diese „Allzweckwaffe“[91] bisher jedoch nur im Bereich des Kollisionsrechts relevant geworden.
In Fällen wie in dem einleitenden Beispiel 3( Rn. 45) hat der EuGH bereits mehrfach Ergebnisse des nationalen IPR korrigiert und ist zu einer Anwendung des Heimatrechts gelangt. Immer ließ sich dabei allerdings auch ein Bezug zur Freizügigkeit oder ein Diskriminierungsaspekt ausmachen (näher daher sogleich Rn. 53).
Die Rechtsprechung des EuGH versteht die Unionsbürgerschaft als eine aus sich heraus bestehende, facettenreiche Rechtsposition, die möglicherweise in dem nun geschaffenen „Kernbereich“ über das hinausgehen kann, was die jeweilige Staatsbürgerschaft für die Bürger der EU bedeutet. Der EuGH wird dafür auch deshalb kritisiert, weil ein solches Verständnis in Art. 20 AEUV nicht wirklich angelegt ist.[92]
Читать дальше