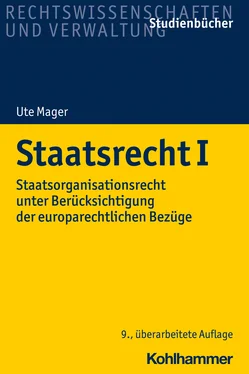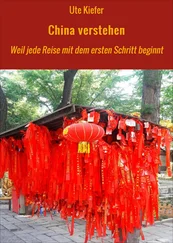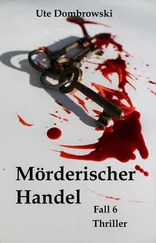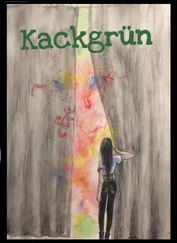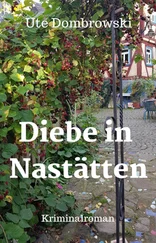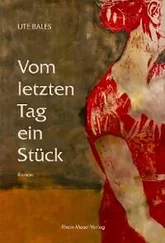147Das gemäß Art. 21 Abs. 4 GG zuständige Bundesverfassungsgericht stellt die Verfassungswidrigkeit einer Partei ebenso wie den Wegfall der staatlichen Finanzierung nur auf Antragfest. Berechtigt, einen solchen Antrag zu stellen, sind nach § 43 Abs. 1 BVerfGG der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Eine Landesregierung kann den Antrag nur gegen eine Partei stellen, deren Organisation sich auf das Gebiet ihres Landes beschränkt. Diese Antragsberechtigten sind ihrerseits nicht verpflichtet, ein entsprechendes Verfahren durchzuführen. Ihnen steht ein weites, nicht jedoch rechtlich völlig ungebundenes Ermessen zu. Die Formulierung, sie könnten nach politischer Opportunität handeln, 77ist deshalb irreführend. Die dezidierte Formulierung des Art. 21 Abs. 2 GG – „sind verfassungswidrig“ – zwingt angesichts des Verfahrensvorbehalts in Abs. 4 und der Regelungsbefugnis in Art. 21 Abs. 5 GG aber auch nicht zur Annahme einer strikten Pflicht. Vielmehr hat der Gesetzgeber eine kluge und praktikable Entscheidung getroffen, indem er den zur Antragstellung berechtigten Verfassungsorganen gemäß § 43 BVerfGG Ermessen eingeräumt hat. 78
Das Bundesverfassungsgericht eröffnet ein entsprechendes Verfahren erst nach Anhörung des Vertretungsberechtigten der Partei (§ 45 BVerfGG). Wird dem Antrag nicht stattgegeben, so kann er nur bei Vorliegen neuer Tatsachen wiederholt werden (§§ 41, 47 BVerfGG). Wird ihm stattgegeben, so ist mit der Feststellung der Verfassungswidrigkeit die Feststellung zu verbinden, dass die Partei aufgelöst und dass ihr verboten ist, Ersatzorganisationen zu bilden. Dieses Verbot ist strafbewehrt (§ 84 StGB). Eine Ersatzorganisationist keine Partei, sondern wie ein Verein zu behandeln. Es gilt Art. 9 Abs. 2 GG, wonach Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, verboten sind. Die dafür geltenden Verbotsverfahren richten sich nach dem Vereinsgesetz.
Hat ein Antrag auf Entscheidung gemäß Art. 21 Abs. 3 GG Erfolg, so stellt das Bundesverfassungsgericht gemäß § 46a BVerfGG fest, dass die Partei für sechs Jahre von der staatlichen Finanzierung nach § 18 PartG ausgeschlossen ist. Verlängerungsanträge sind möglich.
148Angesichts des Risikos, durch ein Verbot eine Partei, die man für verfassungswidrig hält, in den Untergrund zu drängen, 79sind in der Geschichte der Bundesrepublik bisher nur selten Verbotsverfahreneingeleitet und durchgeführt worden; davon waren zweiin den Anfängen der Bundesrepublik erfolgreich: Zum einen das Verfahren gegen die rechtsradikale SRP, zum anderen das Verfahren gegen die KPD. Gegen kommunistische Parteien, die sich nach Auflösung der KPD formiert haben, hat man keine Verbotsverfahren mehr durchgeführt. Zwei weitere Verfahren gegen die rechtsradikale FAP und die Nationale Liste wurden vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig zurückgewiesen, weil die Gruppieren nach ihrem Organisationsgrad und ihren Aktivitäten schon nicht den Anforderungen an eine Partei genügen konnten. 80Damit war für ein Verbot nicht mehr das BVerfG zuständig, sondern die für ein Vereinsverbot zuständige Behörde. Das erste NPD-Verbotsverfahren stellte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2003 ein, nachdem bekannt geworden war, dass Vertrauensleute des Verfassungsschutzes in der Führungsebene der NPD tätig waren. Die tragende Mehrheit des zuständigen Senats folgerte aus diesem Umstand ein Verfahrenshindernis. 81Der Antrag der NPD auf Feststellung ihrer Verfassungskonformitätwar schon mangels Zulässigkeit erfolglos. Weder einfaches Recht noch das Grundgesetz sehen ein solches Verfahren vor. Eine Rechtsschutzlücke ergibt sich daraus nicht, weil der Partei wie ihren Mitgliedern wegen rechtswidriger Beeinträchtigung ihres Status oder ihrer Betätigung andere Rechtsschutzmöglichkeiten offenstehen. 82Das zweite NPD-Verbotsverfahren führte zwar zu der Feststellung, dass die Partei verfassungswidrige Ziele verfolge, jedoch nicht zum Verbot der Partei mangel der erforderlichen „Potentialität der Zielerreichung“. Konsequenz dieses Urteils war die schon dargelegte Ergänzung des Art. 21 GG.
Rechtsprechung (zum Parteiverbot und Verbotsverfahren):BVerfGE 2, 1 – Sozialistische Reichspartei SRP; 5, 85 – Kommunistische Partei Deutschlands KPD; 107, 339 – erstes NPD-Verbotsverfahren (Parteiverbotsverfahren); 133, 100 – Antrag der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands NPD auf Feststellung ihrer Verfassungskonformität; BVerfGE 144, 20 – zweites NPD-Verbotsverfahren.
Literatur: J. Kersten , Parteienverbote in der Weimarer, der Bonner und der Berliner Republik, NJ 2001, 1; T. Kingreen , Auf halbem Weg von Weimar nach Straßburg: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Verbotsverfahren, Jura 2017, 499; T. Kumpf , Verbot politischer Parteien und Europäische Menschenrechtskonvention, DVBl. 2012, 1344; Ph. Kunig , Parteien, HStR III, 3. Aufl. 2005, § 40 Rn. 46 ff.; M. Morlok , Parteiverbote als Verfassungsschutz – Ein unauflösbarer Widerspruch, NJW 2001, 2931; ders. , Das Parteiverbot, Jura 2013, 317; F. Shirvani , Parteiverbot und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, JZ 2014, 1074; F. Stiehr , Das Parteiverbotsverfahren, JuS 2015, 994; U. Volkmann , Dilemmata des Parteiverbotes, DÖV 2007, 577; ders. , Grundprobleme der staatlichen Bekämpfung des Rechtsextremismus, JZ 2010, 209; A. Windoffer , Anspruch einer politischen Partei auf Feststellung ihrer Verfassungskonformität, DÖV 2013, 151.
Fallbearbeitungen: M. Knauff , Das Verbot der RÖP, VR 2003, 239 (Parteibegriff, Tatbestandsvoraussetzungen eines Parteiverbots).
149Die Parteienfinanzierung 83in der Bundesrepublik Deutschland 84hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Die Tatsache, dass die stärksten Parteien über den Gesetzgeber ihr Eigeninteresse fast ungehindert verfolgen können, erschwert die Schaffung einer verfassungsmäßigen Regelung und so musste das Bundesverfassungsgericht fast jede Gesetzesänderung auf diesem Gebiet auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Verfassungsrechtlich vorgegeben sind für die einfachgesetzliche Ausgestaltung der Finanzierung nur die Grundsätze der Freiheitund der (Chancen-)Gleichheitder Parteien. Der Gesetzgeber hat die sich aus diesen Grundsätzen ergebenden Grenzen immer wieder ausgetestet und das Bundesverfassungsgericht zu einschränkenden Konkretisierungen veranlasst.
150Der Grundsatz der Freiheit ist nicht nur, aber insbesondere zu lesen als Grundsatz der Staatsfreiheit. Dieser Grundsatz setzt unmittelbare staatliche Finanzierung unter Rechtfertigungsdruck und zieht ihr Grenzen. Davon zu unterscheiden sind Formen mittelbarer staatlicher Finanzierung, insbesondere durch die steuerliche Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Für deren Ausgestaltung ist vor allem der Grundsatz der Chancengleichheit von Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Chancengleichheit zwischen den Parteien als auch für die Chancen der Bürgerinnen und Wähler, politisch Einfluss nehmen zu können. Hieraus ergeben sich der Höhe nach Grenzen für die Absetzbarkeit von Zuwendungen Privater.
3.6.1Steuerrechtlicher Ansatz
151Nach 1945 war es zunächst selbstverständlich, dass sich die Parteien aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden selbst finanzierten. Jede Form staatlicher Unterstützung war unbekannt. Dies änderte sich 1954 mit der Einführung einer Regelung im Steuerrecht. Danach konnten Spendenan politische Parteien steuerminderndgeltend gemacht werden. Angesichts der Steuerprogression – dh. je mehr man verdient, umso mehr Steuern zahlt man nicht nur absolut, sondern auch prozentual – führte die Möglichkeit der Minderung des zu versteuernden Einkommens durch Spenden an Parteien zu einer Bevorzugungder Parteien, die die Interessen finanzkräftiger Bürgervertraten. Dieser Effekt wurde dadurch verstärkt, dass auch juristische Personen, also Unternehmen, Parteispenden steuermindernd geltend machen konnten.
Читать дальше