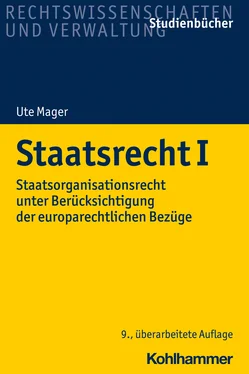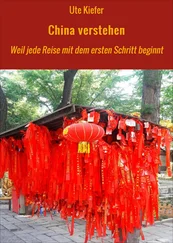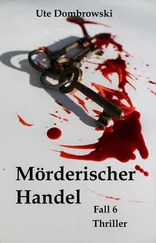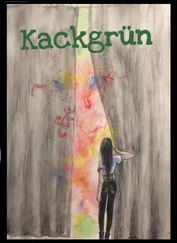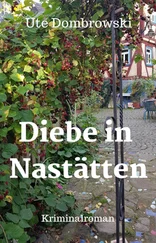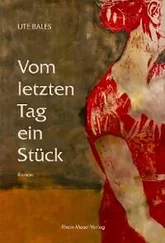Weitere Spezialregelungen gibt es für Seeleute, Binnenschiffer und Häftlinge in § 12 Abs. 4 BWahlG.
Die in § 13 BWahlG aF. aufgeführten Ausschlussgründe betrafen staatsbürgerliche Mängel und Mängel der Einsichtsfähigkeit.
Als staatsbürgerliche Mängelkann man diejenigen Mängel bezeichnen, die zu der in § 13 Nr. 1 BWahlG aF. genannten Aberkennung des Wahlrechts durch Richterspruch führen. „Das Strafgericht kann die aktive Wahlberechtigung nur aberkennen, wenn ein Tatbestand des besonderen Teils diese Nebenfolge explizit vorsieht (vgl. § 45 Abs. 5 StGB). Zu nennen sind etwa die Straftaten des ersten Abschnitts des StGB „Friedensverrat, Hochverrat und Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats“, des zweiten Abschnitts „Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit“ (vgl. §§ 92a, 101 StGB), Angriff gegen Organe und Vertreter ausländischer Staaten (§ 102 Abs. 2 StGB) sowie Wahldelikte (Wahlbehinderung, Wahlfälschung, Wählernötigung, Wählerbestechung, vgl. § 108c StGB), Abgeordnetenbestechung (vgl. § 108e StGB) und bestimmte Straftaten gegen die Landesverteidigung (§ 109i StGB). Das Wahlrecht kann auch vom Bundesverfassungsgericht für die Dauer der Verwirkung eines Grundrechts aberkannt werden (§ 39 Abs. 2 BVerfGG, Art. 18 GG).
Der Gesetzgeber war zudem der Auffassung, dass das nötige Mindestmaß an Einsichtsfähigkeitfür die Ausübung des Wahlrechts den Personen fehlt, die gemäß §§ 1896 ff. BGB unter Betreuung stehen 18(§ 13 Nr. 2 BWahlG aF.) sowie solchen, die sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 iVm. § 20 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus befinden (§ 13 Nr. 3 BWahlG aF.). Hierbei handelt es sich um schuldunfähige Wiederholungsstraftäter. Auf eine Wahlprüfungsbeschwerde hin hat das Bundesverfassungsgericht diese Einschränkungen für zu undifferenziert befunden und deshalb wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und gegen das Diskriminierungsverbot wegen einer Behinderung gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG für verfassungswidrig erklärt. 19Geblieben ist damit nur der Wahlrechtsausschluss aufgrund der Aberkennung durch Richterspruch, § 13 BWahlG nF.
99Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl gebietet nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht die „zusätzliche verfassungsrechtliche Pflicht auch in einem positiven Sinne dafür Sorge zu tragen, dass die Aktivbürger, die aus einem ihrer Person oder in der Ausübung ihres Berufes liegenden Grund freiwillig oder unfreiwillig ihr Wahlrecht am Wahlort nicht auszuüben vermögen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können“. 20Diese Ansicht ist zu undifferenziert. Der Gesetzgeber ist durch den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl gehalten, zumindest denjenigen, die am Wahltag „unfreiwillig“ nicht am Wahlort anwesend sind, die Wahl durch übliche und zumutbare positive Leistungenzu ermöglichen. Allerdings müssen auch die Gefahren der Briefwahl für die geheime und freie Durchführung der Wahl berücksichtigt werden. 21Die Briefwahl ist daher keine bedingungsfreie Alternative zum persönlichen Erscheinen. 22Die Anforderung, die Teilnahme an der Briefwahl mit einer Begründung zu rechtfertigen, hob der Gesetzgeber allerdings durch Gesetz vom 17. März 2008 auf, 23was angesichts der Tatsache, dass es ohnehin kaum möglich ist, die Begründungen zu überprüfen, und im Interesse der Förderung hoher Wahlbeteiligung gerechtfertigt erscheint. 24
100Die Anforderungen an die Wählbarkeit(passives Wahlrecht) konkretisiert § 15 BWahlG. Sie bleiben hinter den Anforderungen an die Wahlberechtigung (aktives Wahlrecht) insoweit zurück, als das Erfordernis der Sesshaftigkeit fehlt. Sie gehen darüber hinaus, als nicht nur auf die in § 13 genannten Ausschlussgründe verwiesen wird, sondern zusätzlich die Aberkennung der Wählbarkeit oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter durch Richterspruch aufgeführt wird. Verwiesen wird damit auf § 45 Abs. 2 StGB, der wie § 45 Abs. 5 StGB eine entsprechende Bestimmung im Besonderen Teil fordert. Neben den Straftaten, die als Sanktion die Aberkennung des aktiven Wahlrechts vorsehen, können die in § 358 StGB enumerierten Amtsdelikte zum Verlust des passiven Wahlrechts führen. Die Wählbarkeit geht auch dann automatisch verloren, wenn jemand wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist (§ 45 Abs. 1 StGB).
Keinen Ausschluss von der Wählbarkeit regelt dagegen Art. 137 GG, wonach die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes, Berufssoldaten, freiwilligen Soldaten auf Zeit und Richtern im Bund, in den Ländern und in den Gemeinden gesetzlich beschränkt werden kann. Hierbei handelt es sich um die Befugnis, durch Gesetz die Unvereinbarkeit (Inkompatibilität) von Abgeordnetenmandat und Tätigkeit im öffentlichen Dienst einzuführen. Dies dient der Vermeidung von Interessenkonflikten 25und der Gewaltenteilung (personelle Gewaltenteilung). 26
2.2.2Unmittelbarkeit der Wahl
101Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl verlangt die direkte Wahl der Abgeordnetendurch die Wählerinnen und Wähler ohne die Zwischenschaltung von Personen, die Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen können. 27Das Wählervotum muss zwingend und berechenbar zur Zusammensetzung des Parlaments führen. Gefordert ist ein Wahlverfahren, „in dem der Wähler vor dem Wahlakt erkennen kann, welche Personen sich um ein Abgeordnetenmandat bewerben und wie sich die eigene Stimmabgabe auf Erfolg oder Misserfolg der Wahlbewerber auswirken kann“. 28An dieser Vorhersehbarkeit fehltes, wenn im Wahlsystem infolge komplexer An- und Verrechnungen von der Bundes- auf die Landesebene und von Zweit- auf Erststimmen 29der Effekt desnegativen Stimmengewichts auftritt. Gemeint ist der Effekt, dass die Abgabe von Zweitstimmen für die Partei A nicht zum Gewinn, sondern zum Verlust eines Mandats für die Partei A führen kann bzw. dass die Abgabe der Stimme für die Liste der Partei A der Partei B zu einem Sitz verhilft. Anders als bei der 5 %-Sperrklausel bleibt hier die Stimmabgabe nicht nur möglicherweise ohne Wirkung, sie wirkt sich vielmehr in unvorhersehbarer Weise entgegengesetzt zum Willen des Wählers aus. „Gesetzliche Regelungen, die derartige Unwägbarkeiten nicht nur in seltenen und unvermeidbaren Ausnahmefällen hervorrufen, sind mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl nicht zu vereinbaren.“ 30Eine verletzungsgleiche Gefährdung der Unmittelbarkeit der Wahl liegt vor, wenn das Wahlverfahren in nicht zu kontrollierender Weise manipulierbar ist. 31
Der Grundsatz der unmittelbaren Wahl verlangt bei Wahlen nach Listen nicht das System der starrengebundenen Liste, wie es das BWahlG in § 6 Abs. 6 Satz 4 für die Bundestagswahl vorsieht. 32Auch bei losegebundenen Listen, bei denen die Wähler auf die Rangfolge durch die Häufung von Stimmen ( Kumulieren) oder durch Rangordnungszahlen Einfluss nehmen können oder sogar durch das Ankreuzen von Bewerbern aus verschiedenen Listen die Zusammensetzung der Liste beeinflussen können (Panaschieren ), besteht der direkte Zusammenhang zwischen Wählervotum und Wahlergebnis.
102Demgegenüber müssen nach der Wahl im Falle des Ausscheidens einer gewählten Person Ersatzleutenach der in der Liste festgesetzten Reihenfolge nachrücken. Wer nachrückt, steht nicht im Belieben der Partei, die die Liste aufgestellt hat. Nach § 48 Abs. 1 Satz 2 und 3 BWahlG ist ein Abweichen von der Reihenfolge nur dann erlaubt, wenn die Person, die an sich nachrücken müsste, nach dem Aufstellen der Liste aus der Partei ausgeschieden ist, auf deren Liste sie steht sowie in wenigen ähnlichen Fällen. Die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung lässt sich damit rechtfertigen, dass die von den Parteien aufgestellten Listen Parteilisten sind (vgl. § 27 Abs. 1 Satz 1 BWahlG), so dass die aufgestellten Bewerber auch Exponenten ihrer Partei sind. 33Mit dem Argument, dass es sich bei den Überhangmandaten um zusätzliche (den Proporz übersteigende) Direktmandate und nicht um Listenmandate handele, hat das Bundesverfassungsgericht das Nachrücken in frei gewordene Überhangmandate aus der Landesliste für unvereinbar mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl erklärt. 34
Читать дальше