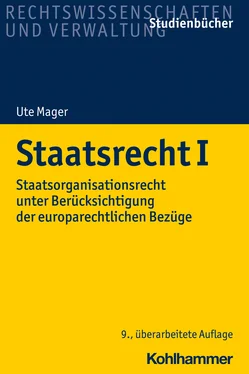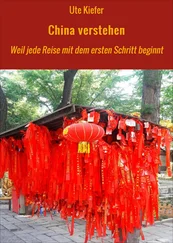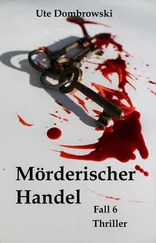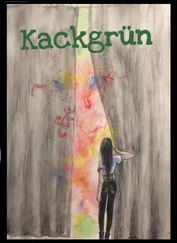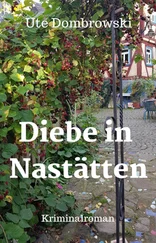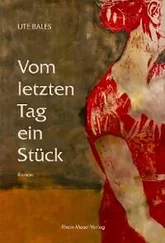93Ein reines Verhältniswahlrechtkommt mit einem Wahlkreis aus, benötigt aber Parteien. Die Verteilung der Sitze im Parlament auf die Vertreter der Parteien findet proportional zur Anzahl der jeweils auf die Parteien abgegebenen Stimmen statt. Dieses System ist besonders geeignet, die politischen Strömungen in einem Land abzubilden. Im Falle eines weit gestreuten Meinungsspektrums müssen ggf. Vorkehrungen gegen Zersplitterung getroffen werden, um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu sichern (zB. durch eine Sperrklausel, siehe Rn. 107).
94Ein reines Mehrheitswahlrechterfordert eine Aufteilung des Wahlgebiets in Wahlkreise, deren Anzahl der Zahl der Parlamentssitze entspricht. Diese Art der Wahl ist stärker personenbezogen. Sie fördert der Tendenz nach die Bildung von klaren Mehrheiten im Parlament. Infolge des systembestimmenden Grundsatzes „the winner takes it all“ kann es jedoch zu einer starken Verzerrung bei der Abbildung des im Staatsvolk vertretenen politischen Meinungsspektrums im Parlament kommen, bei entsprechendem Zuschnitt der Wahlkreise bis hin zu einer Umkehrung der eigentlichen Mehrheitsverhältnisse. In diesem Fall wäre allerdings zu prüfen, ob der Zuschnitt der Wahlkreise gegen den Grundsatz der Gleichheit der Wahl verstößt.
95Anders als die Weimarer Reichsverfassung 6trifft das Grundgesetz keine Aussage über das Wahlsystem. Nach Art. 38 Abs. 3 GG bestimmt ein Bundesgesetz „das Nähere“ über die Bundestagswahl. Gemäß Art. 20 Abs. 3 GG ist der Gesetzgeber dabei an die Vorgaben der Verfassung gebunden. Dem Gesetzgeber kommt somit bei der Wahl des Wahlsystems Gestaltungsspielraum im Rahmen der Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG zu. Die Regelungen über die Bundestagswahlen finden sich im Bundeswahlgesetzsowie in der Bundeswahlordnung. § 1 Abs. 1 Satz 2 BWahlG wiederholt die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und bestimmt das Wahlsystem als eine mit der Personenwahl verbundene Verhältniswahl. Ein neues, bisher in zwei Bundesländern – Brandenburg und Thüringen – aufgetretenes Problem stellt die gesetzliche Verpflichtung der Parteien dar, ihre Listen geschlechterparitätisch zu besetzen. 7Hier ist durchaus zweifelhaft, welche Wahlrechtsgrundsätze betroffen sind: Freiheit, Gleichheit? Am stärksten ist wohl die passive Wahlrechtsgleichheit der Kandidatinnen und Kandidaten berührt. 8Die entscheidende Frage ist, ob die staatliche Pflicht zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zur Beseitigung bestehender Nachteile gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG geeignet ist, eine solche Vorgabe in Abwägung mit dem Selbstorganisationsrecht der Parteien zu rechtfertigen. 9Dies erscheint durchaus zweifelhaft.
2.2Die Wahlrechtsgrundsätze
96 Allgemeinheit, Gleichheitund Freiheitsind für eine demokratische Wahl wesensimmanent. 10Die geheime Durchführungder Wahl sichert deren Freiheit. Die Unmittelbarkeitder Wahl dient der engen Bindung zwischen dem Volk als dem zu repräsentierenden Souverän und den Abgeordneten als den Repräsentanten des Volkes (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG). In neueren Entscheidungen 11hat das Bundesverfassungsgericht zudem den in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG nicht ausdrücklich genannten Grundsatz der Öffentlichkeitder Wahl als verfassungsrechtlichen Maßstab herangezogen. Gemeint ist die Verlässlichkeit der Wahl, die sich in der Nachvollziehbarkeit und Kontrollierbarkeit der Integration des Wählerwillens von der individuellen Stimmabgabe bis zur Sitzverteilung im Bundestag manifestiert. Die Bezeichnung als Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl ist angesichts des ausdrücklichen Grundsatzes der geheimen Wahl sprachlich nicht sehr glücklich, auch wenn die Geheimheit sich allein auf die Stimmabgabe bezieht und § 31 BWahlG feststellt: Die Wahlhandlung ist öffentlich. Die Postulation eines Grundsatzes der Öffentlichkeit der Wahl neben den geschriebenen Wahlrechtsgrundsätzen erscheint auch nicht nötig. Eine Wahl, die den Anforderungen der Verlässlichkeit und Kontrollierbarkeit nicht genügt, ermöglicht Manipulationen hinsichtlich Stimmengewicht und/oder Stimmenzuweisung, die gegen die Grundsätze gleicher und unmittelbarer Wahl verstoßen.
2.2.1Allgemeinheit der Wahl
97Das Erfordernis der Allgemeinheit der Wahl stellt einen speziellen Gleichheitssatzdar. Er verlangt Gleichheit in Bezug auf die Zulassung zum aktiven und passiven Wahlrecht, betrifft also das „Ob“ des Wahlrechts. Der persönliche Anwendungsbereich dieses Gleichheitssatzes ist begrenzt auf das deutsche Staatsvolk. 12Eine weitere verfassungsrechtliche Eingrenzung des Anwendungsbereichs des Allgemeinheitserfordernisses enthält Art. 38 Abs. 2 GG, wonach wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. Diese Formulierung ist irritierend, da die Volljährigkeit gemäß § 2 BGB ebenfalls mit Vollendung des 18. Lebensjahres eintritt. Dies war jedoch nicht immer der Fall. Die Formulierung geht zurück auf die Zeit, als die Senkung des Volljährigkeitsalters von der Vollendung des 21. Lebensjahrs auf das 18. Lebensjahr bereits geplant, aber noch nicht umgesetzt war und für die anstehende Bundestagswahl den 18-Jährigen bereits das aktive, nicht aber das passive Wahlrecht eingeräumt werden sollte. 13
Wie jeder Gleichheitssatz kennt auch das Gebot der Allgemeinheit der Wahl Ausnahmen. Solche Ausnahmen bedürfen eines Grundes, der sich vor dem Zweck des Gleichheitsgebots rechtfertigen lässt. Dieser Zweck ist im Falle der Wahl die demokratische Legitimation des Bundestages durch das Volk. Im Lichte der demokratischen Idee vermittelt jede Person allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Staatsvolk in gleichem Maße Legitimation. Dementsprechend stellen politische, wirtschaftliche und soziale Umstände ebenso wenig wie religiöse oder ethnische Zugehörigkeiten oder gar das Geschlecht rechtfertigende Gründe für den Ausschluss vom Wahlrecht dar. 14In diesem Sinne ist der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl ein strikteroder auch „formaler“ Gleichheitssatz.
98Anforderungen an die Ausübung des Wahlrechts, die sich vor dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl rechtfertigen lassen, enthalten die §§ 12 und 13 BWahlG. Dies ist zum einen das Erfordernis der Sesshaftigkeitim Wahlgebiet. Nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 BWahlG hängt die Wahlberechtigung davon ab, dass die jeweilige Person seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehat oder sich sonst gewöhnlich aufhält. Absatz 2 formulierte hiervon Ausnahmen für im Ausland lebende Deutsche. Diese Ausnahmen waren ursprünglich restriktiv gefasst 15und zielten darauf, eine tatsächliche Verbindung zwischen den im Ausland lebenden Deutschen und den Verhältnissen in Deutschland sicherzustellen. Angesichts der zunehmenden Mobilität und Kommunikationsmöglichkeiten lockerte der Gesetzgeber die Anforderungen immer weiter, bis schließlich nur noch das Erfordernis eines dreimonatigen ununterbrochenen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland – gleichgültig zu welchem Zeitpunkt – übrigblieb. 16Die Relevanz dieser Unterscheidung zwischen Auslandsdeutschen mit Blick auf das Wahlrecht ist kaum noch sachlich fassbar. Ein dreimonatiger Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, gleichgültig in welchem Alter oder vor wie vielen Jahren, sagt über die Verbundenheit mit Deutschland oder über Vertrautheit mit den deutschen Verhältnissen nichts aus. Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung deshalb für verfassungswidrig erklärt. 17Durch erneute Änderung des BWahlG mit Wirkung vom 3.5.2013 lautet die aktuelle Fassung nunmehr: „Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch diejenigen Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die am Wahltag außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie 1. nach Vollendung ihres vierzehnten Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt oder 2. aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind.“
Читать дальше