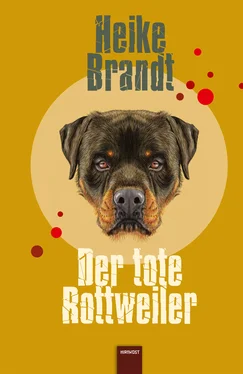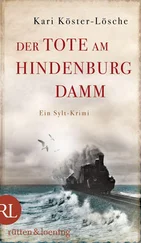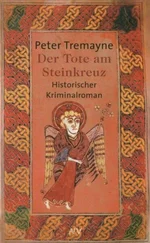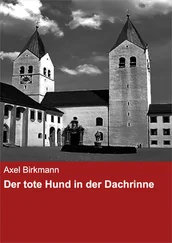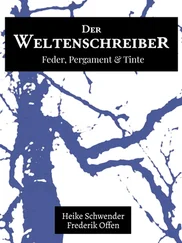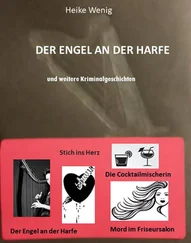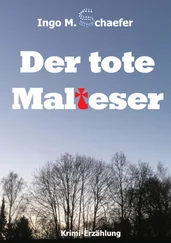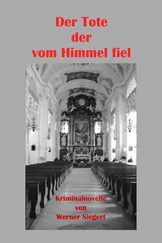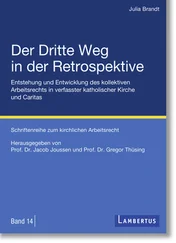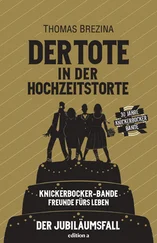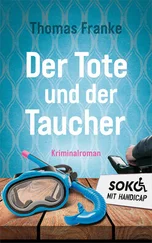„Ja“, antwortet Julika verwundert.
Worauf will die hinaus?, überlegt sie.
„Genau.“
Amal blickt nachdenklich auf den Stein.
„Fünftausend Zwangsarbeiter, dreihundert Tote. Krass, oder?“
Julika nickt.
„Und ich soll auch da …“, sagt Amal und atmet durch. „Also … deine Mutter, die hat mir einen Ausbildungsplatz im Werk besorgt, fürs nächste Jahr, als Industriekauffrau. Und das ist total wichtig, weil, also …“
Sie bricht ab und zieht die Augenbrauen hoch.
„Und wo ist das Problem?“, fragt Julika.
„Na ja. Erst fand ich das ja auch super, weil, mein Vater …“
Sie zögert wieder und setzt noch mal neu an:
„Egal, ich will Geld verdienen, wenn ich mit der Schule fertig bin, und ich will einen guten Beruf haben. Und ich glaub schon, dass mir Industriekauffrau Spaß macht. Aber jetzt … Ich meine, im Werk produzieren die ja nicht irgendwas. Sondern Waffen.“
„Ja klar“, sagt Julika. „Seit zweihundert Jahren. Und richtig gute. Die ganze Welt kauft bei uns ein.“
Kaum haben die Worte ihren Mund verlassen, denkt Julika: Warum sage ich das? Ich klinge genau wie Papa.
Amal nickt energisch.
„Genau. Und mit den Waffen wird Krieg gemacht. Will ich das? Also ich meine, will ich da mitmachen? Und das tue ich doch, wenn ich da arbeite, oder?“
„Musst du wissen“, murmelt Julika.
Das geht ihr jetzt alles viel zu schnell. Zudem ist ihr völlig unklar, wie jemand mit siebzehn Industriekauffrau werden wollen kann. Das klingt in ihren Ohren sowas von öde, egal, in was für einem Betrieb. Nicht ihre Welt.
„Sicher“, sagt Amal. „Bloß – ich weiß es eben nicht.“
Julika guckt auf die Uhr. Halb vier. Spätestens um vier wird sie bei Opa erwartet.
„Von dem Denkmal hier hat mir eine alte Frau aus unserem Haus erzählt“, erklärt Amal, ohne auf Julika zu achten. „Das haben Privatleute gemacht, gleich nach dem Krieg, auf ihrem Grundstück, weil die Stadt es woanders nicht erlaubt hat. Die Stadt wollte überhaupt kein Denkmal, auf keinen Fall, nirgends, hat die Frau gesagt. Niemand wollte sich an die Verbrechen der Nazis erinnern oder womöglich daran erinnert werden. Ist ja allen immer gut gegangen mit dem Werk, hat sie gesagt.“
Amal zieht ihr Handy aus der Tasche und fotografiert.
„Außer denen, die mit den Waffen umgebracht wurden, denke ich mal. Und den Zwangsarbeitern, natürlich“, fügt sie hinzu, nachdem sie das Foto gemacht hat.
„Wo soll das Lager denn gewesen sein?“, fragt Julika.
Ihr will das alles gar nicht so recht in den Kopf. Ringsum sieht sie nur Einfamilienhäuser mit schmucken Gärten, über die jetzt dunkle Schatten grauer Wolkenbänke ziehen.
„Da hinten“, sagt Amal und zeigt auf eine Wiese am Ende der Straße. „Da ist noch ein Mahnmal, das hat die Stadt machen lassen, vor ein paar Jahren, hat die Frau gesagt. Auf einmal! Über siebzig Jahre später!“
Amal nimmt ihr Rad, schwingt sich drauf und meint:
„Ich guck mir das an. Kommst du mit?“
„Okay. Ich mach nur noch schnell ein Foto.“
Als sie sich der Wiese nähern, sehen sie in deren Mitte ein gepflastertes, aus mehreren runden Steinblöcken umfasstes Rund mit einer gewaltigen, aufrechtstehenden Platte in der Mitte. Von weitem sieht es aus wie ein riesiges Buch.
Und das soll es auch sein. Vorne drauf steht Buch der Erinnerung, Zwangsarbeit von 1939-1945 . Die Seiten bestehen aus mehreren beweglichen grausilbernen Metall-Tafeln, auf die jede Menge Informationen eingraviert sind.
Beide Mädchen stellen sich davor und lesen stumm. Von 1940 bis 1945 waren mindestens zwölftausend Menschen aus ihren von der deutschen Wehrmacht besetzten Heimatländern hierher verschleppt worden. Ohne diese Zwangsarbeiter wäre die Produktion im Werk und in den anderen Rüstungsfirmen des Ortes zusammengebrochen, denn die deutschen Arbeiter waren ja an der Front. Die zur Arbeit gezwungenen Menschen wurden in den örtlichen Rüstungsfabriken ausgepresst, in Lager eingepfercht, in Baracken gesteckt, sie litten unter Hunger, Ungeziefer, Kälte, Krankheiten. Und ganz sicher auch unter Heimweh, Sehnsucht nach ihren Familien und Freunden.
„Das ist doch Wahnsinn, oder?“, sagt Amal. „Ich meine, die Leute, die mussten Waffen herstellen, damit deutsche Soldaten Leute in ihrer Heimat damit umbringen konnten! Wie krank ist das denn? Wie haben diese Menschen das bloß ausgehalten?“
Julika hat das Gefühl, in ihrem Kopf ist ein Sturm ausgebrochen. Ihr Blick bleibt an den Namen der Menschen hängen, die im Lager gestorben sind.
„Wasili Kurtschuwi“, liest sie laut. „Guck mal, der ist nur siebzehn geworden, so alt wie ich jetzt bin.“
Sie versucht sich vorzustellen, wie das wäre, wenn sie in ein fremdes Land verfrachtet werden würde und dort von morgens bis abends in einer Fabrik schuften und als Gefangene in einem Barackenlager leben müsste.
Niemals würde sie das durchhalten.
„Sogar Kinder sind im Lager geboren …“, sagt Amal, „… und gestorben: Anatoli, Wanda, Tamara, Fernando, Lydia …”
Sie zählt stumm weiter.
„Einundvierzig. Manche haben noch nicht mal einen Vornamen bekommen.“
„Mein Opa Gunter ist zu der Zeit geboren, im Krieg. Auch hier im Ort. Aber nicht im Lager. Und er lebt noch“, sagt Julika tonlos. „Ich geh gleich zu seinem Geburtstag.“
Amal betrachtet jetzt die Karte, auf der alle Lager eingezeichnet sind. Zwölf hat es im Ort gegeben, aber Spuren davon gibt es so gut wie keine mehr.
Als die beiden Mädchen alles durchgelesen und angeguckt haben, setzen sie sich auf zwei der Granitsteine und sagen eine Weile lang gar nichts.
Julika ist unbegreiflich, wieso sie bis jetzt nichts von den Zwangsarbeitern gewusst hat. Das hätten sie doch in Geschichte machen müssen. Was für ein ungeheuerliches Verbrechen! Einfach Menschen verschleppen und für sich schuften lassen. Wie Sklavenhalter. Julika ist die freundliche Wiese mit dem idyllischen Fluss dahinter auf einmal unheimlich. Als säßen sie auf einem Friedhof.
„Wo sind die Gestorbenen eigentlich begraben?“, sagt sie schließlich. „Davon steht nichts auf den Tafeln.“
„Stimmt. Und wie sah das hier aus früher? Baracken mit einem Zaun drum herum? Mit Wachen? Und Strammstehen?“, fragt Amal. „Waren die Häuser hier schon da?“
„Und was haben die Leute hier darüber gedacht? Das Lager war doch nicht zu übersehen“, meint Julika. „Und die aus den Lagern mussten ja irgendwie in die Fabriken kommen, also sind sie durch die Straßen gelaufen oder sind gefahren worden. Das müssen doch alle gesehen haben!“
„Bestimmt“, meint Amal. „Das müssen alle gewusst haben! Aber hätten sie was dagegen machen können?“
„Keine Ahnung“, meint Julika. „Vielleicht nicht, vielleicht hatten sie Angst, selber ins Lager zu kommen. Also ich glaub, das war nicht so unrealistisch. Aber …“
Julika fährt sich mit den Zähnen über die Lippen.
„Aber wer sagt denn, dass sie was dagegen machen wollten? Vielleicht fanden die es ja gut?“
„Meinst du?“, fragt Amal skeptisch. „Und haben erst nach dem Krieg gemerkt, was sie eigentlich gemacht haben?“
Julika zuckt die Achseln.
„Ja, kann doch sein“, meint Amal. „Und dann war denen das nach dem Krieg so total peinlich, dass sie nicht drüber reden konnten und alles ganz schnell vergessen wollten? Meine Eltern reden auch nicht über den Krieg.“
„Weil es ihnen peinlich ist?“
„Nee, das nicht, stimmt. Okay, dann haben sich die Leute hier vielleicht schuldig gefühlt? Waren sie ja auch irgendwie, oder?“
„Weiß ich nicht, doch, schon, keine Ahnung. Aber trotzdem, als es vorbei war mit den Nazis, nach dem Krieg – wie konnten die dann einfach so weiterleben, einfach alles wegschieben und vergessen und so tun, als wär nichts gewesen? Mein Uropa, der muss das doch alles mitgekriegt haben, der hat doch im Krieg in der Firma gearbeitet!“
Читать дальше