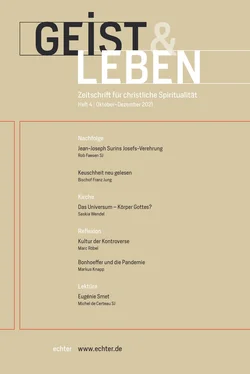Richtig verstanden, gehört eine keusche Gesinnung zu den Grundhaltungen aller, die in der Seelsorge tätig sind und tagtäglich mit Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu tun haben. Im Weihegebet zur Diakonenweihe findet diese innere Haltung Erwähnung: „Das Evangelium Christi durchdringe ihr Leben. Selbstlose Liebe sei ihnen eigen, unermüdliche Sorge für die Kranken und die Armen. Mit Würde und Bescheidenheit sollen sie allen begegnen, lauter im Wesen und treu im geistlichen Dienste.“ 6Mit „selbstloser Liebe“, nachgehender, echter „Sorge“, „Würde und Bescheidenheit“ und vor allem mit dem Hinweis auf das „lautere Wesen“ und die „Treue im Dienen“ klingen bereits wesentliche Dimensionen der Keuschheit an. Nach einem kurzen Blick in die Ikonographie sollen diese deutlich werden.
Die Ikonographie kennt die Darstellung des Heiligen Josef mit der Lilie, dem Lilienzepter oder dem blühenden Lilienstab. Im letztgenannten Motiv fließen ikonographisch zwei Traditionen ineinander. Hier ist zunächst die biblische Überlieferung vom blühenden Aaronstab zu nennen (Num 17,23), durch den die Erwählung Aarons von Gott bekräftigt wurde. Der blühende Stab lässt sich auch als Reminiszenz an das apokryphe Protoevangelium des Jakobus (ProtJak 8.3–9.1) verstehen. Dieser Überlieferung nach sammelte der Priester Zacharias alle Witwer Israels – unter ihnen auch Josef – mit der Auflage, einen Stab mitzubringen. An wessen Stab sich ein Wunderzeichen zeigte, der sollte Maria zur Frau bekommen. Schließlich blieb nur noch Josefs Stab übrig, aus dem eine Taube hervorging, die sich auf Josefs Haupt niederließ. Beide Traditionen dienen dem gleichen Zweck. Sie unterstreichen die Legitimität desjenigen, an dessen Stab sich eine wundersame Wandlung vollzieht. Die Lilie selbst gilt als Symbol der Reinheit und der Unschuld, als „Lilie unter Disteln“ (Hld 2,2). Seit alters steht die Lilie als Symbol für die keusche Gesinnung des- oder derjenigen, der oder die sie in den Händen hält. Josef selbst wurde in der Frömmigkeitsgeschichte geradezu als Personifikation der Keuschheit gesehen und als solche verehrt.
Noch einmal: Die Tugend der Keuschheit ist nicht zu verkürzen auf sexuelle Enthaltsamkeit. Ebenso wenig ist Keuschheit generell auf den Bereich menschlicher Sexualität einzugrenzen, auch wenn diese sicher eine zentrale Konkretion keuschen Lebens darstellt. Keuschheit meint demgegenüber eine innere Grundhaltung in der Beziehung zu sich selbst, zum anderen und letztlich zu Gott. Sie zeichnet sich aus durch einen reflektierten und sensiblen Umgang, der der Würde des Menschen entspricht und diese Würde zur Geltung bringt. Die Tugend der Keuschheit geht daher jeden Menschen an, unabhängig von sexueller Orientierung und Lebensstand, verheiratet oder unverheiratet, ledig oder bewusst zölibatär lebend. Sie ist kein „Privileg“ der Priester und Ordenschrist(inn)en, auch wenn sich diese aufgrund ihrer zölibatären Lebensform und ihrer Gelübde in besonderer Weise von der Tugend der Keuschheit in die Pflicht genommen wissen.
Die Tradition hat die Tugend der Keuschheit innerhalb der Kardinaltugend der temperantia , also des Maßhaltens, verortet. Denn Keuschheit bedeutet, das rechte Maß zu finden in Bezug auf die eigene Sexualität und Geschlechtlichkeit. Insofern hat die Tugend der Keuschheit nichts mit kirchlicher Verbotsmoral 7zu tun, auch wenn sie leider allzu oft genau hier thematisiert wurde. Das Mühen um die Tugend der Keuschheit gehört vielmehr in den Kontext der „Kunst des Liebens“ (E. Fromm) 8. Sie ist ein ambitioniertes, lebenslang unabgeschlossenes Projekt.
Die Keuschheit hat die caritas ordinata 9, die geordnete Liebe, im Blick. Seit frühester Zeit deutete die geistliche Überlieferung den Ruf der Braut aus dem Hohenlied Salomos „er hat in mir die Liebe geordnet“ (Vulgata Hld 2,4b: „ordinavit in me caritatem“) als Verweis auf Christus. 10In Ihm, dem „schönsten aller Menschen“ (Ps 45,3), findet die unendliche Liebessehnsucht des Menschen ihre Erfüllung. Von Christus her ordnet sich das menschliche Streben nach Erfüllung. Gemäß christlicher Anthropologie ist der Mensch von Beginn an auf ein Gegenüber angelegt und kommt erst im göttlichen wie einem menschlichen Gegenüber zur Erfüllung. Die Keuschheit bewahrt uns vor der Ansicht, wir wären uns selbst genug und die anderen dienten nur dazu, unsere Wünsche zu erfüllen.
Zur Illustration der Unkeuschheit bedient sich Thomas von Aquin eines Bildes aus dem Tierreich. Er vergleicht sie mit dem Blick des Löwen auf einen Hirsch: Der Löwe sieht den Hirsch nur durch sein Beuteschema. Die Eleganz und Schönheit des Hirsches vermag er nicht wahrzunehmen. In ihrem gierigen Zugriff verhindert Unkeuschheit also, die Wirklichkeit in ihrer Fülle und Schönheit zu sehen. Sie ist egoistische Brechung der eigenen Wahrnehmung und „schätzt“ die andere Person immer nur insofern, als sie der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse dient. 11„Ein unkeuscher Mensch“, führt Josef Pieper aus, „will vor allem etwas für sich selbst; er ist abgelenkt durch ein unsachliches ‚Interesse‘; sein stets angespannter Genusswille hindert ihn, in jener selbstlosen Gelöstheit vor die Wirklichkeit zu treten, die allein echte Erkenntnis ermög-licht.“ 12Positiv gewendet ist die Geste der Keuschheit „die Berührung voller Ehrfurcht. Denn schon die Berührung der Haut berührt die Person, und die Person ist der Ehrfurcht wert. So berührt selbst die Keuschheit nicht das tiefste Geheimnis des Anderen, denn sein Geheimnis ist der Unversehrtheit wert.“ 13Insofern muss die Liebe immer wieder neu ausgerichtet, neu geordnet werden, um nicht hinter dem zurückzubleiben, wozu der Mensch in Christus berufen ist.
Keuschheit und Selbsterkenntnis
Wer ein keusches Leben führen will, muss regelmäßig über sich selbst Rechenschaft ablegen. Das erfordert, sich über die eigene Sexualität im Klaren zu sein und an der persönlichen sexuellen Reife zu arbeiten. Darüber hinaus verlangt es, die eigene Geschlechtlichkeit in die Persönlichkeit zu integrieren, so dass der Mensch in der Lage ist, seine inneren Regungen und Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen, sie zu reflektieren und angemessen mit ihnen umzugehen. Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit im Umgang mit sich und mit anderen sind gefragt. Nur so können tragfähige Beziehungen aufgebaut und eingegangen werden. Die schonungslose Ehrlichkeit verhilft auch dazu, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man bemerkt, dass man an seine Grenzen stößt und das eigene Leben Gefahr läuft, außer Kontrolle zu geraten.
Gerade im Blick auf das zölibatäre Leben heißt Selbsterkenntnis überdies, sich über die eigene Motivation bei der Berufswahl klarzuwerden. Der einmal eingeschlagene Weg ist immer wieder neu zu wählen und die eigene Entscheidung neu zu bekräftigen. Berufung ist kein einmaliger Vorgang an einem bestimmten Zeitpunkt des eigenen Lebens. Der göttliche Ruf und Anruf ist demgegenüber in Regelmäßigkeit neu zu vernehmen, um sein Leben danach auszurichten.
Wirkliche Selbsterkenntnis schenkt Klarheit über die eigene Rolle und Klarheit darüber, wer der andere als mein Gegenüber ist. Die innere Standortbestimmung ermöglicht, die diesem Gegenüber angemessene Verhaltensweise zu finden. Dies gilt umso mehr, als es in der Seelsorge oftmals schwer ist, professionelle Beziehungen von vertrauteren zwischenmenschlichen oder gar freundschaftlichen Beziehungen zu unterscheiden. 14Die rechte Nähe und die gebotene Distanz sind dabei stets neu zu vermessen und auszuloten. Keuschheit setzt eigene Grenzen und respektiert fremde Grenzen. Das schenkt innere Freiheit und stellt die Beziehungen zum anderen auf ein verlässliches Fundament. Respekt vor dem Geheimnis des anderen und Diskretion eröffnet den Raum der Ehrfurcht voreinander, innerhalb dessen Beziehungen zu wachsen vermögen und wirkliche Liebe sich vertiefen kann. 15
Читать дальше