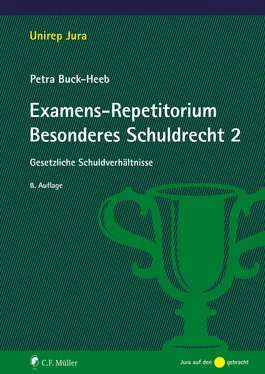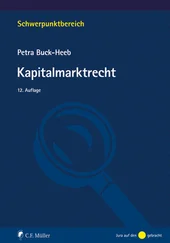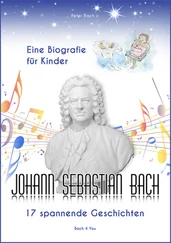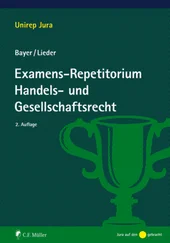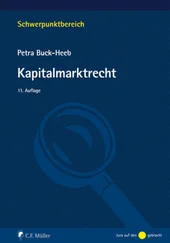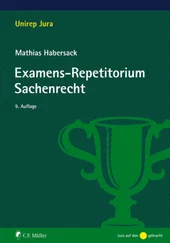118
Voraussetzung ist des Weiteren, dass der Geschäftsführer auch weiß, dass es sich um ein fremdes Geschäft handelt. Kenntnisse seines Vertreters muss er sich nach § 166 zurechnen lassen. Liegt lediglich fahrlässige Unkenntnis vor, ist dies kein Fall der Geschäftsanmaßung, sondern des § 687 Abs. 1 (irrtümliche Eigengeschäftsführung). Außerdem muss der Geschäftsführer das Geschäft als eigenesführen wollen und somit Eigengeschäftsführungswillen haben. Zudem darf er zur Geschäftsführung nicht berechtigtsein.
119
Geht der Geschäftsherr nach GoA vor, haftet der Geschäftsführer auch auf Auskunft und Rechenschaft (§§ 681 S. 2, 666) sowie Verzinsung (§§ 681 S. 2, 668). Andererseits ist der Geschäftsherr dem Geschäftsführer zum Ersatz seiner Aufwendungen verpflichtet. Anspruchsgrundlagefür den Geschäftsführer ist § 687 Abs. 2 S. 2, der ausdrücklich auf das ausgeübte Wahlrecht des Geschäftsherrn abstellt.
120
Die Bedeutung des § 687 Abs. 2 zeigt Fall 12[5]: Journalist J interviewt den bekannten Schauspieler D für eine Reportage und macht dabei auch einige Fotos. D lässt sich u.a. auf dem Motorroller des J ablichten. Dieses Foto verkauft J der Motorrollerfirma M für deren Reklame. Er versichert, D sei mit dieser Veröffentlichung einverstanden. M veröffentlicht daraufhin das Bild im Rahmen eines Inserats in mehreren Zeitschriften und erwähnt den Namen des D. D will wissen, ob er Ansprüche aus GoA gegen J hat. J will wissen, ob er ggf. Gegenansprüche als Geschäftsführer hat.
1. D könnte einen Anspruch auf Herausgabe des empfangenen Entgeltsnach §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 667haben. Dann müsste J wissentlich ein fremdes Geschäft als eigenes geführt haben, d.h. das Geschäft muss (wenigstens auch) dem Rechts- und Interessenkreis eines anderen angehören. Ein fremdes Geschäft könnte J geführt haben, indem er die Fotoaufnahme von D ohne dessen Erlaubnis an M zu Werbezwecken weitergab. Nach § 22 Abs. 1 KunstUrhG dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. J hat das Foto durch Weitergabe an die M verbreitet. Eine Einwilligung des D in die Weitergabe liegt nicht vor. Allerdings dürfen Bilder ausnahmsweise auch ohne die Einwilligung verbreitet werden, wenn die Voraussetzungen des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KunstUrhG vorliegen. Hiernach ist die Verbreitung von Bildern in Bezug auf Personen der Zeitgeschichte aufgrund des überwiegenden Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit auch ohne Gestattung des Abgebildeten zulässig.
Der bekannte Schauspieler D ist eine solche Person der Zeitgeschichte. Die Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 KunstUrhG greift jedoch nur ein, wenn die Verbreitung eines Bilds der Person der Zeitgeschichte tatsächlich dem schutzbedürftigen Informationsbedürfnis der Allgemeinheit dient. Demgegenüber steht hier für J das kommerzielle Interesse an einer möglichst lukrativen Verwertung des Bilds im Rahmen der Werbung im Vordergrund. Die einschränkenden Voraussetzungen des § 23 Abs. 1 KunstUrhG liegen mithin nicht vor. J hat durch die Weitergabe des Bilds an M ein Geschäft vorgenommen, das in den Rechtskreis eines anderen gehört (Recht des D am eigenen Bild, § 22 KunstUrhG), also fremd war. J wusste auch um seine mangelnde Berechtigung, da er der M wahrheitswidrig von der Zustimmung des D erzählte.
J muss das fremde Geschäft als eigenes behandelt haben, d.h. er muss in den fremden Rechts- oder Interessenkreis in eigennütziger Absicht eingegriffen haben. Das ist hier der Fall, da J den D vom Ganzen nicht in Kenntnis gesetzt hat. Damit liegt hier eine angemaßte Eigengeschäftsführung des J vor.
Rechtsfolgeist, dass J so behandelt wird, als habe er das fremde Geschäft für Rechnung des Geschäftsherrn geführt. Die allgemeine Deliktshaftung sowie die allgemeinen Vorschriften (§§ 812 ff., 987 ff.) werden zugunsten des geschädigten „Geschäftsherrn“ verstärkt, indem ihm die besonderen Herausgabe- und Schadensersatzansprüche (§ 687) der GoA inklusive der Nebenansprüche (§§ 683, 661 ff.) zuerkannt werden.
Nach §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 667 muss J daher das durch die angemaßte Eigengeschäftsführung Erlangteherausgeben. Von der Pflicht zur Herausgabe des Erlangten ist – wie bei § 816 Abs. 1 S. 1 – auch das aufgrund eines schuldrechtlichen Vertrags zugeflossene Äquivalent umfasst. Der Geschäftsführer hat also auch einen erzielten Gewinnherauszugeben, und zwar unabhängig davon, ob der Geschäftsherr selbst ein solches Geschäft vorgenommen hätte oder der Gewinn aufgrund des besonderen Verhandlungsgeschicks des Geschäftsführers höher als üblich ausgefallen ist[6]. D kann daher von J das Honorar verlangen, welches J von M für die Werbeaufnahmen erhalten hat.
2. D könnte auch einen Anspruch auf Schadensersatznach §§ 687 Abs. 2 S. 1, 678(Übernahmeverschulden) haben[7]. Hat der sich in fremde Angelegenheiten einmischende Eigengeschäftsführer erkannt, dass sein Handeln dem Willen des Geschäftsherrn widerspricht, haftet er nach §§ 687 Abs. 2, 678 auf Schadensersatz. Im vorliegenden Fall ist die Höhe der Schadensersatzpflicht des J – in Ermangelung eines dem D konkret entstandenen Schadens – nach dem Entgelt zu bemessen, das in vergleichbaren Fällen an Schauspieler für die Einwilligung in eine Bildweitergabe zu Werbezwecken gezahlt wird[8].
3. Verlangt der Geschäftsherr Herausgabe des durch die Geschäftsführung Erlangten (§§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 667) oder macht er einen Schadensersatzanspruch geltend (§§ 687 Abs. 2 S. 1, 678), so richten sich die Gegenansprüchedes Geschäftsführers nach §§ 687 Abs. 2 S. 2, 684 S. 1. Nach deren Wortlaut ist der Geschäftsherr verpflichtet, dem Geschäftsführer alles, was er „durch die Geschäftsführung erlangt“ hat, nach Bereicherungsrecht herauszugeben[9]. Die Verweisung des § 684 S. 1 auf das Bereicherungsrecht scheint zu dem Ergebnis zu führen, dass der Geschäftsherr dem Geschäftsführer das durch die Geschäftsführung Erlangte herausgeben muss, das er seinerseits gerade nach §§ 681 S. 2, 667 erlangt hat. Das Erlangte würde also von einem zum anderen geschoben.
Die Formulierung des § 684 S. 1beruht jedoch auf einem Redaktionsversehen[10]. Sie meint nicht etwa, dass der Geschäftsherr (D) das Geschäftsführungsergebnis herausgeben muss, also das, was er zuvor vom Geschäftsführer (J) nach § 667 erlangt hat. Zweck der Bestimmung ist vielmehr, dass der Geschäftsführer, wenn er das durch die Geschäftsführung Erlangte herausgeben muss, zumindest seine Aufwendungenersetzt verlangen kann, soweit der Geschäftsherr durch sie noch bereichert ist[11]. Die Verweisung auf das Bereicherungsrecht in §§ 687 Abs. 2 S. 2, 684 S. 1 bezieht sich also nicht auf das sonst Erlangte, sondern nur auf die vom Geschäftsführer getätigten Aufwendungen. Der Herausgabeanspruch nach §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 667 soll dem Geschäftsherrn (kondiktionsfest) erhalten bleiben.
Der Geschäftsherr D ist somit nach § 684 S. 1 verpflichtet, dem Geschäftsführer dessen Aufwendungen zu ersetzen, wenn dieser die Ansprüche nach § 687 Abs. 2 S. 1 geltend macht[12]. Hier kann J den Teilbetrag des Honorars einbehalten, mit dem die Nutzung der von ihm als Urheber gefertigten Fotoaufnahme (vgl. §§ 2 Abs. 1 Nr. 5 bzw. 72 UrhG) abgegolten wird.
Dritter Teil Deliktsrecht
§ 8 Grundlagen
I. Systematik des Deliktsrechts
121
Im Deliktsrecht wird die Frage der Verantwortlichkeit einer Person für einen Schaden geregelt, der unabhängig von einer Vertragsbeziehung entstanden ist. Das Gesetz geht grundsätzlich vom Verschuldensprinzipaus. Die Haftung trifft denjenigen, der den Schaden rechtswidrig und schuldhaft verursacht hat[1]. Die Beweislast für das Verschulden trägt regelmäßig der Geschädigte als Anspruchsteller. Dies gilt etwa für § 823 Abs. 1, § 823 Abs. 2 iVm. einem Schutzgesetz, §§ 824, 826, 839 und 830 Abs. 1 S. 1 sowie 830 Abs. 2.
Читать дальше