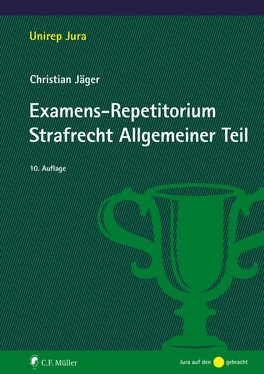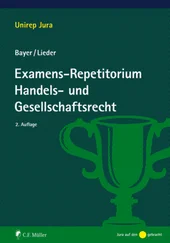c)Durch dieses Verhalten ist auch eine konkrete Gefährdung des Lebens des W sowie einer fremden Sache von bedeutendem Wert eingetreten. Diesbezüglich kann auf die Ausführungen zu § 315d II StGB verwiesen werden.
d)Hinsichtlich dieser Gefahrschaffung ist auch hier zumindest bedingter Vorsatz gegeben. Auch diesbezüglich sowie bezüglich des Zurechnungszusammenhangs zwischen dem verkehrswidrigen Verhalten und der Gefährdung kann ebenfalls auf die Ausführungen zu § 315d II StGB verwiesen werden.
2. Rechtfertigungs- und Schuldausschließungssgründesind auch hier nicht ersichtlich.
3. Ergebnis:A hat sich auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315c I Nr. 2a, d StGB strafbar gemacht.
IX. § 221 I Nr. 1 StGBdurch den Unfall mit W
Für § 221 I Nr. 1 StGB fehlt es bereits an der Verursachung einer hilflosen Lage des W. Dieser wurde laut Sachverhalt unmittelbar getötet, sodass eine hilflose Lage, die ein zumindest kurzfristiges Weiterleben des Opfers voraussetzt, überhaupt nicht entstand.
Hinweis: Es ist fraglich, ob § 221 StGB überhaupt notwendig geprüft werden muss.
X. Gesamtergebnis und Konkurrenzen
A hat sich wegen Mordes und tateinheitlich hierzu wegen Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen mit Todesfolge strafbar gemacht, § 315d V StGB. Der gleichzeitig verwirklichte § 315d I i.V.m. II StGB tritt dahinter im Wege der Gesetzeskonkurrenz zurück. Dagegen stehen nach wohl h. M. § 315c I Nr. 2a, d StGB und § 315d V StGB in Tateinheit,[91] da das Wettrennen den konkreten Unrechtsgehalt der Straßenverkehrsgefährdung nicht ausweist (hier grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren an Kreuzungen) und daher zusätzlich im Urteilstenor Ausdruck finden muss (a.A. bei ensprechender Begründung vertretbar).
Zusatzfrage: Das LG Berlin [92] hatte auch B wegen mittäterschaftlichen Mordes verurteilt. Der BGH hat jedoch die Zurechnung der Handlung des A zur Person des B im Wege der Mittäterschaft gem. § 25 II StGB aus grundsätzlichen Erwägungen bezweifelt: Mittäterschaft setze einen gemeinsamen Tatplan und eine gemeinsame Tatbegehung voraus. Für einen gemeinsamen Tatplan genügt es jedoch nicht, dass sich die beiden Fahrer einig waren, ein Rennen zu fahren. Vielmehr muss sich der gemeinsame Tatplan auch auf den konkreten Tatbestand, also die Tötung eines Menschen beziehen. [93] Dafür, dass zu Beginn des Rennens eine solche Absprache erfolgt ist, liefere der Sachverhalt ebensowenig Anhaltspunkte wie für eine konkludente sukzessive Erweiterung des Tatplans auf die Tötung einer anderen Person im Verlaufe des Rennens. Eine Mordstrafbarkeit des B über mittäterschaftliche Zurechnung scheitere also schon an der fehlenden Handlungszurechnung gem. § 25 II StGB. [94] Der BGH hat daher die Sache diesbezüglich erneut zurückverwiesen. Zu welchem Ergebnis das Gericht bei B kommen wird, ist noch offen. Naheliegend wäre eine Verurteilung wegen versuchten Mordes in Nebentäterschaft. Denn wenn A bedingten Tötungsvorsatz vor dem Durchqueren der Kreuzung hatte, müsste B, der mit annähernd gleicher Geschwindigkeit und unter vergleichbaren Bedingungen fuhr, ebenfalls bedingten Vorsatz und damit Tatentschluss gehabt haben. Sollten künftig Straßenrennen an dieser Kreuzung mit vergleichbarer Geschwindigkeit stattfinden, müsste sogar ein versuchter Mord angenommen werden, wenn überhaupt nichts passiert. Zwar würde der BGH möglicherweise eine solche pauschale Konsequenz unter Hinweis auf die konkreten Bedingungen jedes Einzelfalls bestreiten, jedoch sind kaum Sonderbedingungen denkbar, die bei einer solchen Geschwindigkeit zu einem anderen Urteil führen könnten. Roxin/Greco gehen gar gänzlich pauschal davon aus, dass es die extrem hohe Geschwindigkeit war, die im konkreten Fall ausnahmsweise eine Bestrafung wegen Mordes rechtfertigte. [95] Dann führt aber an einer Verurteilung wegen versuchten Mordes in künftigen Fällen bei vergleichbarer Geschwindigkeit, Uhrzeit und Belebtheit dieses Kreuzungsbereichs kein Weg vorbei. Bleibt freilich die Frage, bei welcher Geschwindigkeit sich diese Einschätzung ändern soll. Sind 140 km/h oder 100 km/h eine Geschwindigkeit, die die Beurteilung ändern kann? Roxin/Greco gehen davon aus, dass ein Versuch in einem solchen Fall in Frage käme, jedoch nur, wenn das Opfer unmittelbar gefährdet wurde. Dies scheint wohl auf eine Leugnung eines untauglichen Versuchs in diesem Bereich hinauszuführen, was freilich unhaltbar wäre, weil es sowohl für den Tatentschluss als auch für das unmittelbare Ansetzen auf die Vorstellung des Täters ankommt. All dies zeigt, dass man sich im Beliebigen bewegt und das Urteil hochproblematisch bleibt. Entscheidet man sich bei B übrigens gegen einen Mordversuch, so bliebe für ihn nur eine Strafbarkeit nach §§ 315d V, 315c I Nr. 2a, d StGB (§§ 222, 229 StGB würden hinter § 315d V StGB zurücktreten).
9. Zusatz: Der dolus eventualis in der Klausurbearbeitung
105
In der Klausur sollte man sich für die Ernstnahmetheorie entscheiden und sie ggf. mit der Gefährdungstheorie absichern. Dies veranschaulicht folgender
Fall 8:A ist in die Wohnung des B eingedrungen, um diesen auszurauben. Plötzlich steht B vor ihm und schreit um Hilfe. Um B zum Schweigen zu bringen, würgt A ihn mit einem Lederriemen. Dem A ist der Tod des B höchst unlieb, ja sogar unangenehm und er hofft deshalb, dass dieser überleben werde. Allerdings erkennt er, dass B auch sterben kann, was er allerdings akzeptiert, um ungestört „weiterarbeiten“ zu können. B stirbt. Hat sich A nach § 212 StGB strafbar gemacht? ( Lederriemen-Fallnach BGHSt 7, 369; hier verkürzt wiedergegeben)
106
Lösung:
A könnte sich wegen vorsätzlicher Tötung gem. § 212 StGBstrafbar gemacht haben.
I. Tatbestandsmäßigkeit
1. Objektiver TatbestandA hat den Tod des B kausal und objektiv zurechenbar verwirklicht.
2. Subjektiver TatbestandDieser setzt bei § 212 StGB Vorsatz voraus, wobei dolus eventualis genügt. Problematisch ist vorliegend allerdings, ob A bedingt vorsätzlich oder nur bewusst fahrlässig im Hinblick auf den Todeserfolg gehandelt hat. Dieses Problem stellt sich vor allem deshalb, weil A der Tod des B unangenehm war. a)Nach der sog. Wahrscheinlichkeitstheorie ist Vorsatz gegeben, wenn sich der Täter den Erfolg als wahrscheinlich vorstellt. Gegen sie ist allerdings einzuwenden, dass sich Wahrscheinlichkeitsvorstellungen des Täters kaum feststellen lassen und die Willensseite im subjektiven Tatbestand vernachlässigt wird. b)Gleiches gilt für die Möglichkeitstheorie, für die entscheidend ist, dass der Täter den Erfolg für möglich hält. Denn auch sie beschreitet einen Weg der Rechtsunsicherheit und bedeutet im Übrigen einen Verzicht auf das voluntative Element im Vorsatz. c)Den Gegenpol zu den eben genannten objektivierenden Theorien bildet die von der Rspr. vielfach verwendete Billigungstheorie, derzufolge Vorsatz zu bejahen ist, wenn der Täter den Erfolgseintritt billigend in Kauf nimmt, nicht dagegen, wenn er ihn innerlich ablehnt und auf sein Ausbleiben hofft. Danach wäre hier bedingter Vorsatz zu verneinen. Auch gegen diese Theorie spricht aber, dass sie zu wenig am Rechtsgüterschutz ausgerichtet ist. d)Maßgeblich können nämlich keine Gefühle und Hoffnungen sein, sondern die Frage, ob sich der Täter für die mögliche Tatbestandsverwirklichung entschieden hat. Entscheidend muss daher sein, ob der Täter die Möglichkeit des Erfolgseintritts ernst nimmt und sich mit ihr abfindet. Nach einer so verstandenen Ernstnahmetheorie bzw. Einwilligungstheorie kann es nicht ausreichen, dass der Täter nur ins Blaue hinein auf einen günstigen Ausgang hofft. Entscheidend ist vielmehr, ob der Täter den Erfolg ernsthaft für möglich gehalten hat und dennoch in dessen Eintritt einwilligt, indem er ihn hinnimmt. So lag es aber im vorliegenden Fall, weil sich A mit dem tödlichen Ausgang abgefunden hatte. Er erkannte nämlich die konkrete Gefahr der Rechtsgutsverletzung und ließ sich dennoch nicht von seinem Verhalten abhalten. A handelte daher mit bedingtem Tötungsvorsatz.
Читать дальше