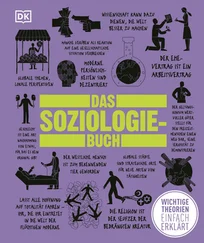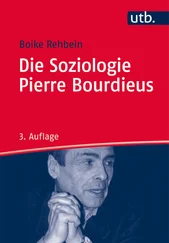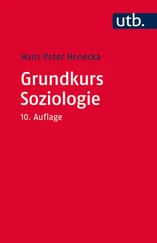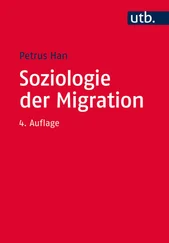Wichtig ist zum einen, dass die Wahl der Beeinflussungsmittel dem Sinn des Handelns der anderen Menschen, die beeinflusst werden sollen, entsprechen bzw. mindestens nicht widersprechen. Denn wer Liebe einsetzt und einen nur am Geld interessierten Menschen vor sich hat, kann das Beeinflussungsziel leicht genauso verfehlen, wie jemand, der/die an Solidarität appelliert, obwohl der andere Mensch im Feindschaftsmodus ist. Bei einem Entscheider brauche ich nicht an dessen schlechtes Gewissen zu appellieren und von einer Herrscherin brauche ich keine Unterwürfigkeit zu erwarten. Zudem müssen die Einflusspotentiale in Beeinflussungskonstellationen nicht gleich verteilt sein. Die Asymmetrie von Einflussmöglichkeiten dürfte sogar der Normalfall sein, weil entweder die gesellschaftlichen Strukturen keine Gleichheit zulassen, wie dies z. B. in hierarchisch strukturierten Organisationen der Fall ist, oder die Menschen verfügen schlicht nicht über die gleichen Kapitalien, das heißt, nicht über die gleiche Menge an Geld, Freund:innen, Bildung usw. (bzw. die Qualität der Ressourcen unterscheiden sich). Zudem macht die Dynamik von Beeinflussungen aus, dass diese auf die Konstellation selbst zurückwirken kann, wodurch sich die Beeinflussungschancen zugunsten oder -ungunsten eines Menschen oder einer Gruppe verschieben können. Wenn aus der Mitarbeiterin eine Vorstandsvorsitzende wird, verändert dies nachhaltig ihr Einflusspotential auf ihre vorherigen Vorgesetzten. Aus den mehr oder minder zufälligen wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Menschen können also immer Chancen der Beeinflussung erwachsen. Gerade die Asymmetrien in den Einflussmöglichkeiten treiben oftmals die Interaktionen an, z. B. in einer Mutter-Kind-Beziehung, in der die Mutter scheinbar zunächst mehr Macht und mehr Möglichkeiten hat als das Kind, das Kind aber auf die Selbstansprüche der Mutter zurückwirkt, bspw. auf den von der Mutter an sich selbst gerichtete Anspruch, stets die Hauptverantwortliche für die Betreuung des Kindes zu sein. In ähnlicher Weise drückt die starke formale Macht von Vorgesetzten gegenüber den Angestellten nicht alles an Macht aus, die in dieser Beziehung ausgeübt wird, weil ein erhebliches Beeinflussungspotential ebenfalls bei den Angestellten liegt, die z. B. mit ›Dienst nach Vorschrift‹ drohen können.
Die Dynamiken von Beeinflussungskonstellationen können sehr komplex werden. Und je nach neu entstandener Situation kann anderer Handlungssinn, können andere Bedürfnisse und Strategien wirksam werden. Schon zwischen zwei Menschen können Mehrfach-Überlagerungen vorherrschen. Das heißt, es bestehen zugleich z. B. Interessen an verschiedenen Dingen, die erst einmal nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie bei diesen beiden Menschen zugleich vorkommen.
Ich mag vielleicht zur Entspannung gern in Ruhe puzzeln, wozu ich meine Partner:in als Unterstützung benötige, weil ich nicht gut puzzeln kann. Mein:e Partner:in mag gerne laut Heavy Metal hören und findet meine Schallplattensammlung dazu sehr geeignet. Als Paar müssen wir dann ruhiges, gemeinsames Puzzeln und das laute Abspielen meiner Schallplatten miteinander abstimmen.
Je mehr Menschen in einem Kontext involviert sind, desto mehr solcher Mehrfach-Überlagerungen können entstehen. Zweckbündnisse, Seilschaften und andere Zuordnungen sowie das Auftauchen ganz besonderer Einfluss-Konstellationen (inklusive Herrscher:innen, Schlichter:innen, Publikum usw.) formen die Beeinflussungskonstellationen zusätzlich, was wiederum das handelnde Zusammenwirken noch unübersichtlicher macht.
Bislang haben wir mit den akteurtheoretischen Überlegungen von Uwe Schimank zwei generelle Arten des handelnden Zusammenwirkens präsentieren können: Beobachtungs- und Beeinflussungskonstellationen. Zusammenwirken wird bereits durch das gegenseitig unterstellte Beobachten anderer Menschen hervorgebracht. Wir haben dies am Beispiel der Mode beschrieben. Zudem haben wir gezeigt, dass die gegenseitige Beeinflussung durch entsprechende Mittel (bspw. Geld, Macht oder Liebe) eine weitere Form des Zusammenwirkens darstellt. Aus diesem Grund stellen wir nun jene spezifische Betrachtungsweise des handelnden Zusammenwirkens dar, die an diese Überlegungen anknüpft und mit deren Hilfe aufgrund einfacher Annahmen sehr klare Schlussfolgerungen zu ziehen möglich ist: die sog. Spieltheorie.
Die Spieltheorie ist eine Methode, die unterstellt, dass beim Spielen das Ergebnis nicht davon abhängt, was ein:e Spieler:in alleine tut. Sondern beide Spieler:innen handeln, meistens mit einem Blick auf die Handlungen des Gegenübers, und beide orientieren sich daran simultan genauso wie an dem Verlauf des Spiels. Das, was am Ende insgesamt dabei herauskommt, ist abhängig von der wechselseitigen Orientierung der Spieler:innen aneinander. Dies macht die Spannung von Spielen aus. Und wie bei den meisten Gesellschaftsspielen auch, versuchen die Spieler:innen, das Beste für sich selbst rauszuholen. Hierfür muss man schlauer sein als die anderen Spieler:innen.
Spiele benötigen Regeln, die vorschreiben, was an Handlungen erlaubt und was verboten ist. Diese Regeln geben zudem vor, über welche Informationen die Spieler:innen verfügen dürfen. Liegt das alles fest und das Spiel geht los, dann interessiert vor allem, mit welchen Strategien die einzelnen Spieler:innen vorgehen und was das dann im Gesamtergebnis bewirkt. Als Strategie wird in der Spieltheorie der vollständige Plan verstanden, wie sich jede:r Spieler:in in den möglichen Spielsituationen verhalten wird. Nehmen wir ein berühmtes Beispiel.
Beispiel: »Denn sie wissen nicht, was sie tun«
In dem Film »Rebel Without a Cause« (dt. »Denn sie wissen nicht, was sie tun«) spielt James Dean einen um Liebe und Anerkennung ringenden Rebellen. Unter anderem nimmt er an einer Mutprobe teil, dem sog. »Chicken Game«. Dabei tritt er gegen seinen Widersacher Buzz an. Beide rasen mit gestohlenen Autos auf eine Klippe zu. Wer zuerst vor der Klippe ausweicht, ist der Feigling; wer zuletzt ausweicht, ist der Gewinner. In dem Film springt Jim (gespielt von James Dean) kurz vor der Klippe aus seinem Auto, während Buzz an dem Türgriff hängen bleibt und zu Tode in die Tiefe stürzt.
Die spieltheoretische Modellierung dieses »Chicken Games« geht davon aus, dass beide Spieler:innen zwei Handlungsoptionen haben: Ausweichen oder Weiterfahren. Was Spieler:in 1 tut, ist abhängig davon, was Spieler:in 2 tut und umgekehrt. Denn wenn z. B. Spieler:in 1 sehr früh ausweicht, dann hat Spieler:in 2 gewonnen und kann risikolos den Sieg wortwörtlich einfahren. Da dies simultan für beide Spieler:innen gilt und beide gewinnen wollen, gilt für die Option des Ausweichens, dass diese so spät wie möglich umgesetzt werden muss. Auch dies gilt allerdings für beide Spieler:innen. Daraus nimmt das Spiel seinen Reiz: Es gewinnt jene:r Spieler:in, der/die weiterfährt, während der/die andere ausweicht. Weichen beide zugleich aus, hat niemand gewonnen. Zugleich ist der Schaden gering, weil auch niemand verloren hat. Fahren beide weiter, stürzen beide die Klippe hinunter und es gibt nicht nur keine:n Sieger:in, sondern auch noch den größtmöglichen Schaden für beide.
Üblicherweise wird diese Situation in eine Matrix übertragen. Darin wird für jedes Ergebnis eine fiktive »Auszahlung« eingetragen. Der größte Nutzen wird hier mit einer Auszahlung von 6 gerechnet. Wenn das Gegenüber zugleich ausweicht, bedeutet dies eine Auszahlung von 2 (man hat verloren, aber überlebt). Weichen beide zugleich aus, haben beide überlebt und sind zugleich keine Verlierer:innen, das Spiel hat quasi unentschieden geendet. Allerdings hat auch niemand gewonnen, weshalb beide Spieler:innen eine Auszahlung von 4 erhalten. Die niedrigste Auszahlung von 0 erhalten beide, wenn sie beide weiterfahren und niemand ausweicht, weil dann beide sterben und zugleich niemand gewinnt (  Abb. 2).
Abb. 2).
Читать дальше
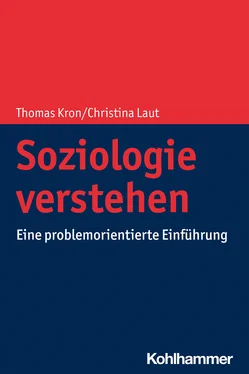
 Abb. 2).
Abb. 2).