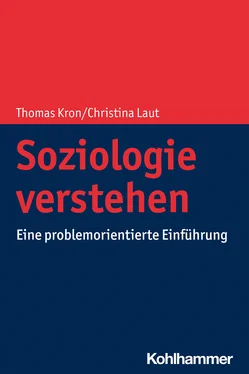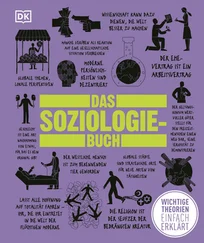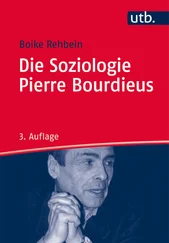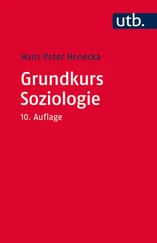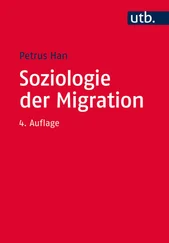• erstens gemeint, dass die Prozesse bzw. die Ergebnisse des handelnden Zusammenwirkens nur selten dem entsprechen, was die beteiligten Menschen sich gewünscht haben. Man wollte als Beispiel vielleicht eine wundervolle und spaßige Geburtstagsfeier ausrichten, aber es ist einfach keine gute Stimmung zustande gekommen.
• Zweitens kommen die Menschen nicht selten im Nachhinein zu der Bewertung, dass das Geschehen nicht nur als unerwünscht, sondern auch das eigene Handeln letztlich als gescheitert zu betrachten ist. Um das Beispiel fortzusetzen, mag der/die Gastgeber:in zu der Bewertung kommen, dass die Musikauswahl (die o. g. Partner:in hat ausschließlich die Heavy-Metal-Platten abgespielt) einer guten Stimmung nicht zuträglich gewesen und sie/er deshalb gescheitert ist.
• Drittens wird das Geschehen des handelnden Zusammenwirkens oftmals gar nicht derart reflektiert, sondern im Regelfall eher gedankenlos mit eigenem Handeln begleitet – also etwa schlicht eine Musikliste für die Party erstellt, die sich an den je aktuellen Charts orientiert oder eben die Schallplatten rausgegriffen, die gerade vorhanden sind. Die Interaktionsorientierung ist eher gedankenlos.
• Und viertes geschieht auch das Handeln selbst oftmals eher beiläufig, das heißt, es ist gar nicht auf ein bestimmtes Geschehen oder Ziel des handelnden Zusammenwirkens ausgerichtet. Das Handeln ist dann weniger ein willentlicher Akt etwa in dem Sinne, dass der Mensch einen starken Drang verspürt, in einer bestimmen Art und Weise zu handeln, z. B. weil er/sie denkt, dies müsse oder soll so sein. Sondern das Handeln geschieht hier beiläufig, ohne eine starke Determination durch ein Müssen oder Sollen. Es geht dann eher darum, was als Können möglich ist und deshalb, weil es geht, einfach umgesetzt wird.
Gescheiterte Handlungen, die beiläufig durchgeführt und gedankenlos bezüglich des dann unerwünschten Prozesses bzw. Ergebnisses des handelnden Zusammenwirkens vollzogen wurden – dies dürfte der deutlichste Fall von Transintentionalität sein.
Beispiele: Elternschaft/Prohibition/Terror
Manche Menschen werden irgendwann Eltern und setzen Kinder in die Welt, ohne dies zu einer reflektierten Entscheidung hinsichtlich des Nutzens, der Kosten und der eigenen Eignung zu machen, einfach weil es sich im Laufe der Paarbeziehung ›so ergeben‹ hat. Transintentionalität wäre dann hier, sich später eingestehen zu müssen, dass man als Elternteil weder den eigenen noch den Ansprüchen des Kindes genügt, man also gescheitert und auch das Kind ›missraten‹ ist. Als ein weiteres Beispiel hat die US-amerikanische Prohibition, das Verbot des Handelns und Konsums von Alkohol, die organisierte Kriminalität in dieser Branche verstärkt. Und der internationale »War on Terror« als Antwort auf die Anschläge vom 09.11.2001 haben zu einer Individualisierung des Terrors geführt, der noch schwieriger zu begegnen ist (Kron 2015).
Und auch wenn es von dort aus graduelle Abstufungen hin zu mehr Intentionalität gibt: Verwunderlich ist nunmehr nicht mehr, dass die meisten gesellschaftlichen Phänomene transintentionale Folgen des handelnden Zusammenwirkens sind. Vielmehr sollte sogar klar geworden sein, wie unwahrscheinlich es unter diesen Bedingungen ist, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist! Man stelle sich die Gesellschaft von vor 200 Jahren vor: Wie unwahrscheinlich ist es eigentlich, dass sie nur 200 Jahre später so aussieht wie jene Gesellschaft, die wir heute beobachten können? Wie unwahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Buch lesen? Die heutige Gesellschaft ist, wie wir sagen, das emergente und transintentionale Ergebnis des handelnden Zusammenwirkens. Emergenz meint hier lediglich, dass die besonderen Eigenschaften der heutigen Gesellschaft nicht in den Menschen selbst zu finden sind. Sondern erst wenn die Menschen in bestimmter Weise handelnd zusammenwirken, kann (nicht: muss) eine solche Gesellschaft entstehen. Dass es so kommt, ist ziemlich unwahrscheinlich, aber eben doch ganz offenkundig möglich.
So gesehen ist die Soziologie eine Wissenschaft zur Erklärung von gesellschaftlichen Unwahrscheinlichkeiten – dies ist ein Grund, der die Soziologie zu einer besonderen und besonders spannenden Wissenschaft macht. Die Frage nach dem Wie des handelnden Zusammenwirkens von Menschen ist wichtig, um möglichst allgemeine Muster zu erkennen, die man zu Erklärungen konkreter historischer Phänomene einsetzen kann. Denn wenn man weiß, wie Menschen generell handelnd zusammenwirken, dann kann man dies auf verschiedenste Kontexte anwenden und erklären, weshalb bestimmte Strukturen sich so formieren, wie sie es tun.
Wir können an dieser Stelle zusammenfassen, dass das handelnde Zusammenwirken unterschiedliche Formen annehmen kann. An den Beobachtungs- und Beeinflussungskonstellationen haben wir herausgestellt, dass handelndes Zusammenwirken sich durch Komplexität auszeichnet. Weder die handelnden Menschen noch die beobachtenden Soziolog:innen sind in der Lage, die Ergebnisse des handelnden Zusammenwirkens exakt vorauszusagen. Wir wollen nun noch eine weitere von Uwe Schimank (2000: 305 ff.) dargelegte Konstellation des handelnden Zusammenwirkens aufführen, die bereits eine Möglichkeit mit sich führt, wie man mit diesen komplexen Prozessdynamiken umgehen kann. Die Rede ist von Verhandlungskonstellationen.
In Verhandlungskonstellationen versuchen die beteiligten Menschen über Beeinflussungskonstellationen hinaus, bindende Vereinbarungen zu treffen. Den Grund, weshalb Menschen sich in Verhandlungen mit anderen Menschen begeben, sehen wir in dem Wunsch nach einem Umgang mit der beschriebenen Komplexität der Prozessdynamiken, der möglichst erwartungssicher die Erfüllung von Bedürfnissen ermöglicht. Kurz: Es ist der Wunsch nach gesellschaftlicher Ordnung, der Menschen miteinander verhandelt lässt. Wovon Verhandlungskonstellationen im Gegensatz zu Beobachtungs- und Beeinflussungskonstellationen nämlich entlasten, ist die Dauerwachsamkeit bzw. Dauerkontrolle. Ganz allgemein kann zwar auch das wechselseitige Beobachten und Beeinflussen für Erwartungssicherheit sorgen. Allerdings muss man sich unter Konstellationsbedingungen des Beobachtens oder Beeinflussens viel mehr auf Abweichungen einstellen, die die Sicherheit der gewonnenen Erwartungen gefährden. Ständig muss man wachsam sein und im Enttäuschungsfall die eigenen Erwartungen schnell anpassen. Ein Verrat ist in Beobachtungs- und Beeinflussungskonstellationen letztlich definitorisch unmöglich, weil ja nichts abgesprochen wurde. Jeder Mensch hat in Beobachtungs- und Beeinflussungskonstellationen immer das Recht, anders zu handeln als vorher – dies macht ja einen wesentlichen Teil der transintentionalen, komplexen Prozessdynamiken aus. In Verhandlungskonstellationen hingegen kann, wenn eine bindende Vereinbarung getroffen wurde, die Dauerwachsamkeit prinzipiell entfallen, weil die Handlungsoptionen beschränkt wurden. Man kann auf die getroffenen Abmachungen vertrauen, was natürlich zugleich bedeutet, dass man umso stärker enttäuscht werden kann.
Um sich in Verhandlungskonstellationen zugunsten einer Komplexitätsreduktion diese ziemlich weitgehende Unaufmerksamkeit leisten zu können, ist Reziprozität eine notwendige Voraussetzung: Die Verbindlichkeit der in den Verhandlungen getroffenen Vereinbarungen muss grundsätzlich für alle beteiligten Menschen Geltung haben. Diese Geltung ist unbedingt, das heißt, sie gilt selbst im Falle einer faktischen Verletzung. Die Verhandlungspartner:innen müssen auch nicht gleich stark oder mächtig sein, trotzdem gilt die Verbindlichkeit für Alle. Deutlich wird dies im Vergleich: Ein im Rahmen von wechselseitiger Beobachtung und Beeinflussung entstandenes Gleichgewicht, z. B. das »Gleichgewicht des Schreckens« im sog. Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion, kann zwar für alle Menschen verbindlich erscheinen. Aber es fehlt dabei die explizite reziproke Selbst-Verpflichtung zur Einhaltung der in Verhandlungen erarbeiteten Absprachen. Dazu müsste grundsätzlich die Bereitschaft vorhanden sein, verhandeln zu wollen. Dies setzt wiederum bestimmte Orientierungen voraus, etwa dass die Menschen sich im Ergebnis mehr Nutzen von Verhandlungen versprechen als von puren Beeinflussungen oder Beobachtungen. Oder man geht eventuell davon aus, dass es gesellschaftlich wünschenswerter ist und man mehr Anerkennung erhält, wenn man mit anderen Menschen verhandelt, anstatt zu versuchen, sie zu übervorteilen. Die Chance, dass Menschen sich verhandlungswillig zeigen, steigt zudem mit einer gewissen Einflusssymmetrie, das heißt, je weniger Menschen einen dominanten Einfluss ausüben können, desto höher ist die Bereitschaft. Eine weitere Bedingung ist, dass die Menschen und die Konstellationen Verhandlungen überhaupt zulassen. Bestimmte Gruppengrößen etwa machen ein Verhandeln miteinander zumindest solange unmöglich, bis Verfahren angewandt werden, die mit diesem Problem umgehen, z. B. die Delegation von Verhandlungen an Gremien, also an Teilgruppen.
Читать дальше