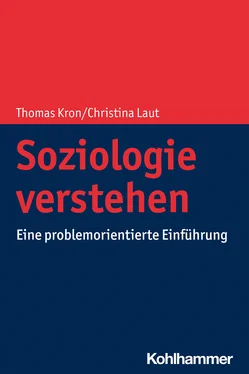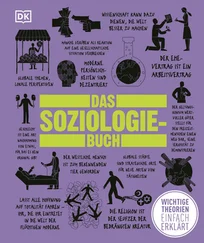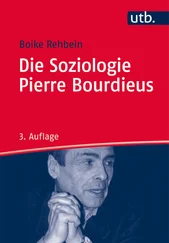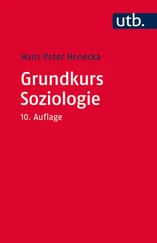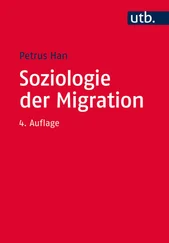Gedanken, Hormone, Blutkreisläufe usw. spielen keine Rolle für die Soziologie. Wir bezweifeln selbstverständlich nicht, dass Menschen denken und durch Hormone und Blutkreisläufe oder ähnliches beeinflusst sind. Diese Dinge sind Randbedingungen des Handelns, so wie es Luft und Magnetismus braucht, damit Menschen überhaupt handeln können. Aber auf diese Dinge müssen wir nicht schauen, weil Gedanken und Blutkreisläufe nicht handelnd zusammenwirken. Handlungen wirken zusammen. Wenn zwei Menschen etwas übereinander denken, dann bleiben die Gedanken in ihren Köpfen und wirken nicht unmittelbar aufeinander ein. Auch die Blutkreisläufe bleiben getrennt, selbst wenn ein Blutdruck mal hoch- oder runtergehen sollte. Der andere Blutkreislauf ist davon nicht direkt betroffen. Ein Zusammenwirken geschieht erst dann, wenn die Gedanken die Köpfe verlassen (was sie natürlich an sich nie, sondern ausschließlich kommunikativ tun) und sich erhitztes Blut in Handlungen übersetzt (in Körperbewegungen, Sprache, Mimik usw.).
Der Begriff des »handelnden Zusammenwirkens« ist zudem etwas präziser als der ebenfalls gebräuchliche Begriff der Wechselwirkung, der als ein Grundbegriff der Soziologie von Georg Simmel 13 gilt. Simmel wollte die Soziologie als eine Wissenschaft verstanden wissen, die die Aufgabe hat, »die Formen des Zusammenseins von Menschen zu beschreiben und die Regeln zu finden, nach denen das Individuum, insofern es Mitglied einer Gruppe ist, und die Gruppen untereinander sich verhalten« (Simmel 1989a: 118). Simmel betont damit, dass gesellschaftliche Phänomene weder aus dem Handeln des einzelnen Menschen noch aus einer anderen übersozialen Einheit heraus erklärt werden kann:
»Man steht z. B. bezüglich der Sprache nicht mehr vor der Alternative, dass sie entweder von genialen Individuen erfunden oder von Gott den Menschen gegeben ist; in die Religionsgebilde braucht sich nicht mehr die Erfindung schlauer Priester und die unmittelbare Offenbarung zu teilen usw. Vielmehr glauben wir jetzt die historischen Erscheinungen aus dem Wechselwirken und dem Zusammenwirken der Einzelnen zu verstehen, aus der Summierung und Sublimierung unzähliger Einzelbeiträge, aus der Verkörperung der sozialen Energien in Gebilden, die jenseits des Individuums stehen und sich entwickeln« (Simmel 1992: 15; Herv. TK/CL).
Ein Alltagsbeispiel mag diese Exempel der »Verkörperung der sozialen Energien in Gebilden« ergänzen.
Die mitreißende Stimmung in einem Fußballstadion ist weder ausschließlich das Ergebnis des Jubels der Fans noch ist das Fußballspiel an sich mitreißend. Erst wenn die Fußballer:innen auf dem Platz mit den Fans auf den Rängen in bestimmter Weise wechselwirken, also etwa durch abgestimmte Fangesänge oder mittels der Koordination der Namensaufrufung bei Auswechselungen der Spieler:innen durch die Stadionsprecher:innen, dann kann eine mitreißende Stimmung entstehen, die bei den einzelnen Menschen wie bei dem Ganzen wiederum Gefühle einer »kollektiven Ekstase« hervorrufen. Diese Ekstase ist ein kollektives Phänomen und entsteht durch Wechselwirkung bzw. durch handelndes Zusammenwirken.
Menschen und ihr Zusammenwirken sind für Simmel jene Inhalte, die mit ihrem Wechselwirken vielfältige Formen der Vergesellschaftung erzeugen. Später hat er diese Unterscheidung von Wechselwirkungen (Inhalte) und Vergesellschaftung (Formen) durch die Unterscheidung von Leben und Form ersetzt, weshalb man Simmel auch als »Lebenssoziologen« (Berger/Kron 2017) bezeichnen kann. Im Anschluss an Simmel hat es verschiedene Versuche gegeben, Wechselwirkungen – also die Dynamiken des handelnden Zusammenwirkens – dadurch zu analysieren, indem man sie kategorisiert. Die Kategorisierung der Wechselwirkungen resultiert dann in dem Aufzählen bestimmter gesellschaftlicher Formen und Prozesse des handelnden Zusammenwirkens. Simmel selbst hat insbesondere in seiner sog. »großen Soziologie« von 1908 einige solcher typischen »Vergesellschaftungsformen« präsentiert, etwa den Streit, die Konkurrenz, die Über- und Unterordnung oder räumliche Ordnungen. Leopold von Wiese (1966) dürfte derjenige Soziologie sein, der im Anschluss an Simmel diese Art der »formalen Soziologie« am weitesten getrieben hat. Von Wiese hat diese »Formalisierung« – verstanden als Verallgemeinerung der Aussagen über Wechselwirkungen und nicht in dem strengen Sinne der Übertragung in eine formale Sprache wie die Mathematik – als Kategorisierung fortgeschrieben. Er unterscheidet dabei Wechselwirkungen zunächst nach Beziehungen erster und zweiter Ordnung. Zu den Beziehungen erster Ordnungen gehören Beziehungen des Zu- und Miteinanders sowie des Aus- und Ohneeinanders und Mischformen aus beiden. Zu den Beziehungen zweiter Ordnung gehören differenzierende Prozesse, integrierende Prozesse, zerstörende Prozesse und »umbildend-aufbauende« Prozesse. Jede dieser basalen Kategorien wird wiederum in weitere Kategorien unterteilt und mit verschiedenen exemplarischen Prozessen versehen. So unterteilt von Wiese die Beziehungen des Zu- und Miteinanders etwa in allgemeine Beziehungen, Annäherung, Anpassung, Angleichung und Vereinigung. Die integrierenden Prozesse z. B. werden in Gleichmachen, Ein-/Über-/Unterordnung und Sozialisierung unterschieden.
Insgesamt ergibt sich hieraus bei von Wiese eine »Tafel der menschlichen Beziehungen in soziologischer Betrachtung«, die sowohl hilfreich als auch wenig fruchtbar ist: Als eine Art Setzkasten ist sie hilfreich, denn vermutlich dürfte das meiste handelnde Zusammenwirken dort unterzubringen sein. Zugleich sind damit ausschließlich Beispiele des handelnden Zusammenwirkens exemplarisch benannt. Man kann dann zwar konkrete Beobachtungen einordnen, aber die Kategorien selbst sind nur begrenzt generalisierbar. Es ist grundsätzlich fraglich, ob es soziale Kategorien gibt, die alle Zeit überdauern, weil sich Gesellschaften permanent wandeln, wie wir noch sehen werden. Es ist also wahrscheinlich, dass neue gesellschaftliche Phänomene entstehen, für deren soziologische Beschreibung man neue Kategorien benötigen würde, wollte man den Setzkasten von Wieses verwenden. Das bei von Wiese aufgeführte »Proletarisieren« bspw. wird heutzutage nicht als zerstörerischer Prozess eingeschätzt. Auch wenn viele Kategorien bei ihm plausibel erscheinen, beseitigt dies nicht die fundamentale historische Vergänglichkeit seiner Kategorien von Formen und Wechselwirkungen – es könnte eben auch anders sein bzw. ist auch schon mal anders gewesen. Es verwundert wenig, dass sich von Wieses Soziologie nicht hat durchsetzen können, wenngleich man etwa die soziologische Netzwerkanalyse als eine ähnliche, auf Formen ausgerichtete Forschungsrichtung verstehen könnte. 14
Die Soziologie interessiert sich also für kollektive Phänomene, die durch handelndes Zusammenwirken von Menschen entstehen. So ganz kommt die Soziologie demnach nicht um das Handeln der Menschen herum. Wichtig für die Soziologie sind dabei die unterschiedlichen Formen und Mechanismen des handelnden Zusammenwirkens. Einige Formen und Mechanismen wollen wir in diesem Buch aus verschiedenartigen theoretischen Perspektiven darstellen. Die Rolle des handelnden Menschen kann in diesen Betrachtungen ganz divergent ausfallen. Im Gegensatz zu Simmel hat insbesondere Max Weber 15 das handelnde Zusammenwirken nicht nur auf die Untersuchung gesellschaftlicher Formen begrenzen wollen, sondern eine systematische Verbindung zu einer Analyse des Handelns gezogen. Wenn Weber von Handlung spricht, dann meint er nicht eine »instinktive« Körperbewegung, etwa wenn ich »Aua« schreie, weil ich mir den kleinen Zeh am Tischbein gestoßen habe. Das wäre Verhalten. Handlung ist für Weber immer sinnhaft aufgeladen. Gemeint ist damit jener durchaus berühmt gewordene Sinnbegriff, dessen Abfrage in keiner Soziologieprüfung zu Beginn des Studiums fehlen darf:
Читать дальше