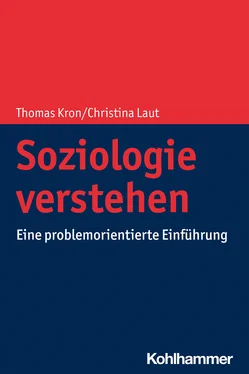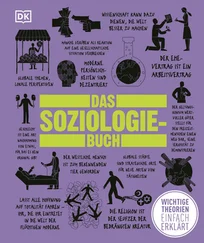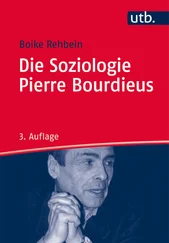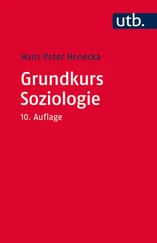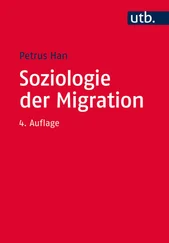»Sinn ist hier entweder a) der tatsächlich α. in einem historisch gegebenen Fall von einem Handelnden oder β. durchschnittlich und annähernd in einer gegebenen Masse von Fällen von den Handelnden oder b) in einem begrifflich konstruierten reinen Typus von dem oder den als Typus gedachten Handelnden subjektiv gemeinte Sinn. Nicht etwa irgendein objektiv ›richtiger‹ oder ein metaphysisch ergründeter ›wahrer‹ Sinn« (Weber 1980: 1).
Auf diesen subjektiv gemeinten Sinn kommen wir noch genauer zu sprechen. Bis hierhin ist subjektiver Sinn das, was Menschen mit ihrem Tun beabsichtigen. Wenn Menschen sich in diesem Sinne sinnhaft verhalten, dann handeln sie. Hier genügt es zunächst zu wissen, dass Weber Handeln auf der einen und soziales Handeln auf der anderen Seite unterscheidet. Seine nicht weniger berühmte Definition zum sozialen Handeln lautet weiter:
»Soziales Handeln […] soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist« (Weber 1980: 1).
Statt die Wechselwirkungen in ihren Ausformungen zu kategorisieren, gibt Weber darüber Auskunft, wie Menschen zusammenwirken, nämlich indem sie jeweils ihren subjektiven Sinn auf das Verhalten anderer Menschen beziehen und sich daran in dem Handlungsablauf orientieren. Wenn ich mich also auf das Verhalten anderer Menschen beziehe und prüfe, inwieweit mir deren Verhalten nützlich ist, dann könnte ich diesen Menschen z. B. auf dem Markt ein Angebot machen, weil ich vermute, dass es sich um potentielle Käufer:innen handeln könnte – dann ist das soziales Handeln. Und dieses soziale Handeln kann sich fortsetzen, wenn die anderen Menschen in der Folge anfangen, mit mir zu feilschen, also ebenfalls ihr Handeln sinnhaft auf mich beziehen und daran orientieren.
Diesem Wie des Zusammenwirkens wollen wir nun weiter auf den Grund gehen. Dabei werden wir sehen, dass die Soziologie zwischen formaleren (wie Simmel) und inhaltlicheren (wie Weber) Darstellungen changiert bzw. darum bemüht ist, die Balance zwischen beiden Betrachtungsweisen zu finden. Es geht uns zunächst darum darzustellen, wie das Handeln mehrerer Menschen mit- und aufeinander wirkt. In einem weiteren Schritt werden wir dann schauen, was als kollektives Ergebnis dabei rauskommt, wenn Menschen handelnd zusammenwirken.
Bei Uwe Schimank (2000; vgl. Kron 2010: 17 ff.; Kron/Winter 2009) nimmt das handelnde Zusammenwirken im Rahmen seiner »akteurtheoretischen Soziologie« eine wichtige Scharnierfunktion zwischen individuellem Handeln und sozialen Strukturen ein. Handelndes Zusammenwirken meint weiterhin bei ihm in etwa dasselbe wie bei Weber das soziale Handeln, also eine Art des Miteinander-zu-tun-Bekommens, indem der eine Mensch sich am anderen Menschen (an dessen Verhalten oder Handeln) sinnhaft orientiert. Diese Orientierung am Anderen muss nicht direkt geschehen, die Menschen müssen sich nicht von Angesicht zu Angesicht begegnen und die Handlungen müssen auch nicht direkt aufeinander einwirken. Es genügt, dass Menschen sich gedanklich vergegenwärtigen, dass das (eventuell auch unterlassene) Handeln der anderen Menschen in irgendeiner Weise – sei es störend, sei es unterstützend oder ermöglichend – eine relevante Einflussgröße für das eigene Handeln darstellt. Es genügt z. B., dass ich mir vorstelle, dass andere Autofahrer:innen dieselbe Strecke fahren wollen wie ich, um mich einen anderen Weg nehmen zu lassen. Meine Vorstellung muss objektiv gesehen gar nicht richtig sein. Es genügt die pure Unterstellung eines Einflusses von anderen Menschen. Die Menschen gehen schlicht davon aus, dass das, was sie handelnd umsetzen möchten, von dem Verhalten oder dem Handeln anderer Menschen abhängt. Es liegen dann sog. »Intentionsinterferenzen« (Schimank 2000: 186 ff.) vor: Überlagerungen der eigenen Absichten mit dem Verhalten oder Handeln anderer Menschen. Und diese Intentionsinterferenzen fordern die Menschen zu einer Abarbeitung auf. Die Überlagerungen können zu Problemen werden, mit denen die Menschen umgehen müssen. Genau dies ist es, was Weber als »soziales Handeln« definiert hatte. Menschen machen sich Gedanken, was andere Menschen wohl denken und tun werden – und sie richten ihr eigenes Handeln danach aus. Die Menschen stellen so gesehen gegenseitig füreinander eine besondere Art Umgebung dar: keine ansonsten interessenlose Natur, sondern eine reflexions- und handlungsfähige Umgebung. Eine soziale Umgebung.
Diese soziale Umgebung führt zur Notwendigkeit sozialen Handelns, weil wir viele Bedürfnisse nur mit Strategien erfüllen können, die wir nicht komplett alleine wie im Schlaraffenland kontrollieren, sondern wo wir eben mit anderen Menschen interferieren.
Beispiele für bedürfnisorientiertes soziales Handeln
Wenn ich Hunger habe, als Strategie zur Bedürfniserfüllung ein Brötchen essen möchte und zugleich kein Brötchen habe, dann muss ich in der Bäckerei ein Brötchen kaufen. Die Bäckerei kontrolliert jene Ressource, an der ich ein Interesse habe. Zugleich hat die Bäckerei ein Interesse an anderen Ressourcen und eine Strategie, um an diese Ressourcen zu gelangen, ist der Gelderwerb, weil man mit Geld verschiedenste Ressourcen erwerben kann. Ich habe Geld als Ressource, an der wiederum die Bäckerei ein Interesse hat.
Ein anderes Beispiel für soziales Handeln als Konsequenz von bedürfnisorientierten Intentionsinterferenzen: Ich möchte an einem Fahrstuhl einem entgegenkommenden Menschen ausweichen, weil mir meine körperliche Unversehrtheit wichtig ist. Dieser andere Mensch scheint – aus meiner Sicht – rechts an mir vorbei zu wollen. Also halte ich nach links. Aber was tut er? Er schwenkt auch nach links. Und schon ist es geschehen, die Kollision der Körper droht. Und warum? Die Antwort liegt auf der Hand: Weil ich nicht alleine unter Kontrolle habe, was das Ergebnis meines Handelns ist. Ob wir aneinander vorbeikommen oder nicht, ist also keine Frage von rechts oder links oder der individuellen Interessen und Möglichkeiten bzw. Bedürfnisse und Strategien alleine, sondern zudem davon abhängig, was der andere Mensch jeweils plant und tatsächlich tut.
Die ›Anderen‹ beim sozialen Handeln können konkrete einzelne und dem Handelnden bekannte Personen, aber auch »unbestimmt Viele und ganz Unbekannte« sein, wie Weber ergänzte. Für das soziale Handeln reicht es auch aus, dass die Menschen nur vorgestellt, reine Phantasieprodukte oder Menschenansammlungen bzw. komplette soziale Gebilde oder Prozesse sind: strafende Götter oder die ›Geschichte‹, das ›Deutsche Volk‹ oder die Fakultät.
Damit sich Menschen wechselseitig derartig in Rechnung stellen können, müssen sie sich zunächst einmal wahrnehmen. Der elementarste Typ einer Konstellation des handelnden Zusammenwirkens ist somit die Beobachtungskonstellation (Schimank 2000: 226 ff.). Menschen beobachten sich – nicht immer, aber oftmals wechselseitig – und passen sich an diese Beobachtung (wiederum manchmal wechselseitig) an. Die Menschen nehmen wahr, dass die mit ihrem Handeln verbundenen Absichten, etwa im Rahmen einer Strategie zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse, von dem Handeln anderer Menschen abhängen.
Ein Beispiel für diese beobachtete Abhängigkeit sind die Preise am Markt. Diese Preise sind nicht nur Auszeichnungen des Warenwerts, sondern zugleich Symbole für wechselseitige Beobachtungen der Konsument:innen. Denn Preise hängen nicht nur von der Qualität des Produkts und noch nicht mal von dem tatsächlichen Kaufverhalten ab, sondern auch davon, wie wir uns alle wechselseitig in unserem Kaufverhalten wahrnehmen. Preise spiegeln diese wechselseitige Beobachtung wider. In ähnlicher Weise sind die Ergebnisse demokratischer Wahlen nicht ausschließlich eine Frage guter oder schlechter Parteipolitik, sondern ebenfalls die Konsequenz der Beobachtung, welcher Partei andere Wähler:innen ihre Stimme geben. Auch das Flair einer Innenstadt ist nicht nur dem Vorhandensein bestimmter Geschäfte geschuldet, sondern dass wir uns wechselseitig beim Flanieren vor diesen Geschäften beobachten – und beobachten, dass und wie wir uns beobachten.
Читать дальше