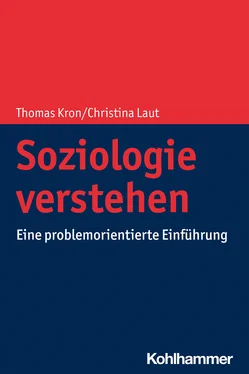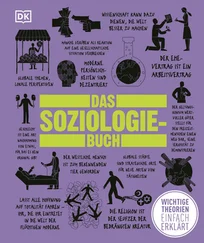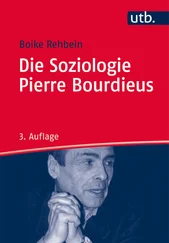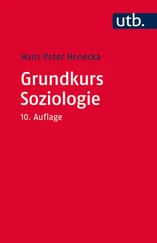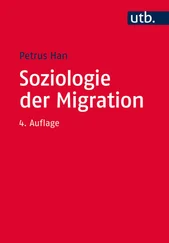4Richard Münch, geboren 1945, ist Professor für Soziologie und galt lange als relevantester Vertreter der parsonsschen Theorie in Deutschland.
5Es wundert nicht, dass wir etliche von Schimanks Vorschlägen hervorragend übernehmen und für unsere Zwecke hier einsetzen können.
6Jeffrey C. Alexander, geboren 1947, ist US-amerikanischer Soziologe und einer der führenden Sozialtheoretiker und Vertreter der Kultursoziologie.
7Wir verwenden die doppelten Bindestriche »//« im Folgenden als Unterscheidungsmerkmal. Die Anregung dazu verdanken wir Ben von https://ueberschriften.de.
8Hartmut Esser, geboren 1943, ist emeritierter Professor für Soziologie und Wissenschaftslehre mit einem Forschungsschwerpunkt zur theoretischen Integration der Sozialwissenschaften.
9Paul B. Hill, geboren 1953, war Professor für Soziologie an der RWTH Aachen mit dem Schwerpunkt Methoden der empirischen Sozialforschung.
10Dies betrifft nur die Vorlesung als Veranstaltungsform. Die weitere Vermittlung der Einführung in die Soziologie wird an der RWTH zu Beginn des Soziologiestudiums in seminaristischer Form geleistet.
11 https://islieb.deund https://isfies.de.
Womit beschäftigt man sich in einem Studium der Soziologie? Der Studienführer der Zeitschrift ZEIT Campus 12 beantwortet die Frage so:
Soziolog:innen … untersuchen, wie sich Menschen in der Gesellschaft verhalten.
Egal, ob am Arbeitsplatz, in Schulen, beim Sport oder auf Dating-Portalen wie Tinder: Soziolog:innen untersuchen sämtliche Aspekte sozialen Handelns. Sie wollen wissen, wie sich Menschen in gesellschaftlichen Gruppen verhalten und welchen Einfluss sie dabei aufeinander nehmen.
Wir werden im Folgenden zeigen, dass diese Darstellung grundsätzlich nicht richtig ist. Zugleich ist diese Betrachtungsweise auch nicht ganz falsch. Und da sind wir auch schon mitten in den üblichen Schwierigkeiten und den wunderbaren Herausforderungen der Soziologie für die Studierenden. Worum es der Soziologie geht, kann man ganz unterschiedlich darstellen. Und je nachdem, welche Darstellung man wählt, sieht die Antwort etwas anders aus. Man kann sich bspw. anschauen, welche wichtigen theoretischen Beiträge es innerhalb der Soziologie gibt und die Theorien im historischen Verlauf rekonstruieren (so z. B. Münch 1994a). Oder man schaut sich die theoretischen und empirischen Themen an, mit denen sich die Soziologie beschäftigt (Joas/Mau 2020). Oder man rückt alle Themen und Theorien unter eine spezifische Perspektive (so Esser 1993, 1999–2001). Alle diese Zugänge haben ihre Berechtigung. Zugleich erscheint die Soziologie im Lichte dieser und weiterer Lehrbücher wie ein Kaleidoskop, das immer andere Dinge präsentiert, wenn man es dreht.
Wir möchten dieser Multi-Perspektivität, die im Fach selbst durchaus umkämpft ist, einen weiteren Sichtwinkel hinzufügen. Damit erhöhen wir zwar einerseits das Spektrum möglicher Betrachtungsweisen der Soziologie, zugleich bietet unsere Perspektive eine gewisse Vereinfachung an. Wir fragen nämlich: Welche Probleme will die Soziologie lösen?
Dies ist eine zugegebenermaßen ziemlich technische Herangehensweise. Wir hören schon jene Kolleg:innen, die da rufen: Wir wollen keine Probleme lösen, sondern soziale Sachverhalte beschreiben und erklären. Okay, zugleich haben auch andere Wissenschaften durchaus Erfolg damit, sich auf Probleme zu konzentrieren. Und schon der erste Blick auf die Probleme, die die Soziologie lösen möchten, ist durchaus spannend, denn dann wird sofort erkennbar, dass es der Soziologie nicht um das Verhalten von Menschen geht, wie der o. g. Studienführer suggeriert! Der Soziologie geht es nämlich um die Beschreibung und Erklärung kollektiver Erscheinungen. Die Soziologie möchte also nicht wissen, weshalb ein einzelner Mensch arm ist, ein bestimmter Mensch in den Krieg zieht oder bestimmte Wertvorstellungen hat. Die Soziologie interessiert sich dafür, wie man Ungleichheit, Kriege oder Werte als kollektive Phänomene erklärt. Ganz allgemein geht es der Soziologie also um Probleme gesellschaftlicher Ordnung.
Zugleich gilt: Wenn wir uns soziologisch mit gesellschaftlichen Ordnungsproblemen beschäftigen, dann sehen wir, dass wir für die Antworten kaum ohne Menschen auskommen. Denn es ist zunächst ja fraglich, weshalb überhaupt gesellschaftliche Ordnungsprobleme auftauchen können. Die etwas ausweichende Antwort darauf ist, dass unsere Welt kein Schlaraffenland ist – jener Ort, an dem die Menschen keine gesellschaftliche Ordnung benötigen, weil die gebratenen Hähnchen dort vom Himmel direkt in den Mund fallen, und in dessen Flussbetten Milch, Honig oder Wein statt Wasser fließen. Das Schlaraffenland als Metapher bedeutet, dass die Menschen sich nicht darum kümmern müssen, wie sie ihrem Bedürfnis der Nahrungsaufnahme nachkommen können, weil dieses Bedürfnis – so wie jedes andere Bedürfnis auch – schlicht dann erfüllt wird, wenn es auftaucht. Die Bedürfniserfüllungen fallen dort quasi alle vom Himmel. Wenn dies der Fall ist und alle Bedürfnisse automatisch für alle Menschen erfüllt sind, dann braucht es keine gesellschaftliche Ordnung. Nun ist eine solche Automatik aber unmöglich.
Zwar weisen alle Menschen einen mehr oder weniger gleichen Satz an Bedürfnissen auf. Zugleich sind die Menschen aber durchaus kreativ darin, unterschiedliche Strategien zu entwickeln, wie man diese Bedürfnisse erfüllen kann. Wer Hunger hat, kann als eine Strategie zur Erfüllung des Bedürfnisses nach Nahrung ggf. gebratene Hähnchen essen. Jedoch stehen nicht für alle Menschen weltweit gebratene Hähnchen zur Verfügung. Diese Ressource ist also knapp. Man muss demnach schauen, dass man genug Lebensmittel für möglichst alle Menschen erzeugt und diese entsprechend verteilt. Dabei sind die Menschen in der einen oder anderen Art und Weise aufeinander angewiesen. Und genau diese Angewiesenheit aufeinander erzeugt Probleme.
Probleme gesellschaftlicher Ordnung gibt es, weil die Menschen es miteinander zu bekommen, wenn sie versuchen, ihre verschiedenen Bedürfnisse mit unterschiedlichen Strategien zu erfüllen.
Und weil es im Schlaraffenland dieses aufeinander Angewiesensein nicht gibt und sich die Menschen nicht in die Quere kommen, gibt es dort auch keine Probleme gesellschaftlicher Ordnung. Die Menschen sind es, die jene Energien liefern, aus denen Probleme gesellschaftlicher Ordnung resultieren, die dazu anhalten, kollektive Lösungen aufzurufen. Und wenn Menschen Ordnungsprobleme erzeugen, weil sie es miteinander zu tun bekommen, dann muss die Soziologie zur Erklärung der Entstehung dieser Probleme die Menschen in ihrem »Miteinander-zu-tun-bekommen« berücksichtigen. Und vermutlich müssen Menschen auch an irgendeiner Stelle zur Erklärung der Lösungen jener Probleme berücksichtigt werden, die ohne Menschen nicht entstanden wären. Kurz: Die Soziologie interessiert sich für gesellschaftliche Probleme und Lösungen und kommt zur Erklärung dieser Probleme und Lösungen nicht an Menschen vorbei.
12 https://www.zeit.de/campus/studienfuehrer-2017/studienfaecher-soziologie-studium(zuletzt abgerufen am 05.02.2021).
2 Wie wir es miteinander zu tun bekommen
»Die Hölle, das sind die anderen« – diesen berühmten Satz von Jean-Paul Sartre können wir so verstehen, dass die Hölle als das Gegenteil des Schlaraffenlandes dadurch entsteht, dass es die anderen Menschen gibt, mit denen wir es immer wieder zu tun bekommen.
Handelndes Zusammenwirken
Für dieses »Miteinander-zu-tun-bekommen« verwenden wir den Begriff des »handelnden Zusammenwirkens« (Schimank 2000: 186). Mit dieser Begrifflichkeit wird zum einen klarer, dass nicht eine einzelne Handlung alleine zur Beantwortung der gesellschaftlichen Ordnungsfragen eine Rolle spielt. Es müssen immer mehrere Handlungen sein, die aufeinander wirken. Und zum anderen gibt es eine Wirkung, um die es uns geht. Und diese für uns relevante Wirkung entsteht dadurch, dass sich Handlungen in die Quere kommen. Wir brauchen von den Menschen also erst mal nicht mehr zu betrachten als ihre Handlungen.
Читать дальше