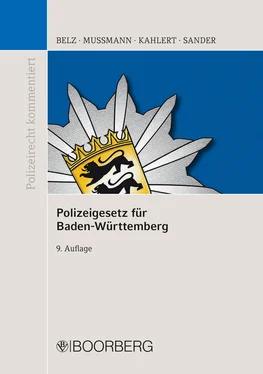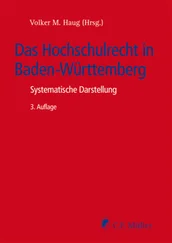Untersagung der unerlaubten Ausübung der Heilkundeals Abwehr weiterer drohender Verstöße gegen die strafbewehrte Vorschrift des § 5 Heilpraktikergesetz (VGH BW VBlBW 2007, 24, 25).
Wird beim Umgang mit Leichengegen Vorschriften des Bestattungsgesetzes (z. B. §§ 25 ff.) verstoßen, so kann zum Schutz der öffentlichen Sicherheit eingeschritten werden (VGH BW, VBlBW 2006, 186, 187 f.).
Verbot der Veranstaltung eines „Hütchenspiels“zur Verhütung der Begehung einer Straftat nach §§ 284, 263 StGB (VG Frankfurt, NVwZ 2003, 1407; 2008, 109); Verbot von Pokerveranstaltungen(VGH Kassel, NVwZ-RR 2009, 62; VG Hamburg, NVwZ-RR 2009, 63).
Die Beschlagnahme von Werkzeug, das gewerbsmäßig dazu benutzt wird, um Kilometerzähler in Kfz. zurückzustellen, dient dazu, eine zukünftige Beihilfe zu betrügerischen Handlungen zu verhindern (OVG Hamburg, DÖV 2004, 928).
Zum „wilden Plakatieren“und Anbringen von Graffiti s. u. RN 39b.
25a
Ein Tätigwerden in Baden-Württemberg aufgrund des Polizeigesetzes kann auch zur vorbeugenden Verhütung von Straftaten im Auslandzulässig sein, z. B. wenn eine Straftat nach § 6 StGB droht, unabhängig davon, ob die Person Deutscher oder Ausländer ist oder eine Straftat eines Deutschen nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB zu erwarten ist, denn in beiden Fällen gilt hinsichtlich der im Ausland bevorstehenden Taten deutsches Strafrecht (vgl. OVG Koblenz, NVwZ 2002, 1528; KG, NVwZ 2002, 1537, 1539).
Beispiel:Eine Polizeibehörde erlässt eine Meldeauflage nach §§ 3, 1 Abs. 1 gegenüber einem Hooligan, der beabsichtigt, nach Frankreich zu reisen, um dort anlässlich eines Fußballspiels Gewalttaten (z. B. §§ 233 ff. StGB) zu begehen (vgl. BVerwG, NVwZ 2007, 1439). Zu Passbeschränkungen vgl. OVG Bremen, DÖV 2009, 86.
26
Ein polizeiliches Einschreiten setzt lediglich die Verwirklichung des objektiven Tatbestandsder Norm aus dem Strafrecht oder Ordnungswidrigkeitenrecht voraus, nicht aber den subjektiven Tatbestand, ein Verschulden, evtl. erforderliche objektive Strafbarkeitsbedingungen (z. B. diplomatische Beziehungen in § 104 a StGB) und auch nicht das Vorliegen von Strafverfolgungsvoraussetzungen (z. B. Strafantrag, §§ 123, 185 ff. StGB).
27
Die Tätigkeit zur vorbeugenden Verhütung von Straftaten darf nicht mit der Strafverfolgungaufgrund der Strafprozessordnung verwechselt werden. Erstere dient dazu, die Begehung von Straftaten zu verhindern, Letztere, eine begangene Straftat zu verfolgen und zu ahnden (Näheres s. u. RN 53ff.). Polizeiliches Handeln dient – hinsichtlich einer Maßnahme – entweder dem einen oder dem anderen Zweck, nicht aber zugleich beiden gemeinsam. Dementsprechend sind die Rechtsgrundlagen entweder dem Polizeigesetz oder dem Strafverfahrensrecht zu entnehmen. Aber selbst dann, wenn bereits eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen wurde, bleibt evtl. noch Raum zur vorbeugenden Verhütung, etwa wenn es gilt, die weitere Begehung eines Dauerdeliktes zu verhindern oder dafür zu sorgen, dass ein strafbarer Versuch nicht vollendet wird.
Beispiel:Wird in einem Sperrgebiet der Prostitution nachgegangen, liegt zumindest eine vollendete Ordnungswidrigkeit nach § 120 Abs. 1 Nr. 1 OWiG vor. Dennoch kann die Polizei zusätzlich aufgrund des Polizeigesetzes zur vorbeugenden Verhütung einschreiten, nämlich zur Verhütung der weiteren Begehung dieser Dauerordnungswidrigkeit.
28
Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit liegt auch dann vor, wenn die Verletzungvon Ge- oder Verbotsnormendes Verwaltungsrechtsdroht. In aller Regel scheidet jedoch ein Einschreiten aufgrund des Polizeigesetzes aus, weil verwaltungsrechtliche Gesetze zumeist eigene spezielle Ermächtigungsgrundlagen enthalten (z. B. § 65 Abs. 1 LBO, § 15 Abs. 2 GewO, § 16 Abs. 1 IfSG). Nur wenn solche fehlen, bleibt Raum für die Anwendung der polizeilichen Generalklausel (konkretisierende Verfügung und dazu s. u. § 3, RN 4).
5. Das Schutzgut „öffentliche Ordnung“
a) Erläuterung des Begriffs
29
Unter „öffentliche Ordnung“ versteht man die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung für ein geordnetes staatsbürgerliches Zusammenleben betrachtet wird. Diese Umschreibung enthält eine Fülle unbestimmter Rechtsbegriffe, die ihrerseits der Auslegungbedürfen. Hierbei ist zu beachten, dass der Begriff „öffentliche Ordnung“ auch in anderen Rechtsgebieten verwendet wird (z. B. Überschrift vor § 123 StGB, § 118 OWiG, Art. 36 AEUV), dort aber durchaus einen anderen Inhalt haben kann.
30
Nur ein Verhalten in der Öffentlichkeitoder ein solches, das in die Öffentlichkeit ausstrahlt, ist beachtenswert. Vorkommnisse in der Privatsphäre gehen die Polizei also nichts an.
31
Das Verhalten muss außerrechtliche Normen(ungeschriebene Regeln, Sozialnormen, gesellschaftliche Wertungen) berühren. Dieses ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Begriff „öffentliche Sicherheit“, weil dort nur Verstöße gegen die Rechtsordnung erfasst sind. Das reduziert den Anwendungsbereichdes Begriffs „öffentliche Ordnung“ auf nahezu Null, da heutzutage fast alle Lebensbereiche rechtlich erfasst sind. Außerdem kann ein Verhalten, das sich als rechtmäßige (Grund-)Rechtsausübung darstellt, niemals ein Verstoß gegen außerrechtliche Normen sein.
32
Außerrechtliche Normen müssen allgemein anerkanntsein, d. h. von einer klaren, deutlichen Mehrheitgetragen werden. Ob eine solche vorliegt, kann regelmäßig nur aufgrund von – subjektiv gefärbten – „Erfahrungswerten“ beurteilt werden. Ob der Begriff „öffentliche Ordnung“ damit dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot entspricht, muss bezweifelt werden. Erschwert wird die Feststellung einer Mehrheit noch dadurch, dass auf die jeweils geltendenaußerrechtlichen Normen abzustellen ist, d. h. diese können sich im Laufe der Zeit ändern und auch – in gewissen Grenzen – lokal unterschiedlich sein. Diese zeitlicheund eingeschränkte lokale Variabilitätaußerrechtlicher Normen ist ein weiterer Grund für den zunehmenden Bedeutungsrückgang dieses Tatbestandsmerkmals.
33
Die Einhaltung der außerrechtlichen Norm muss eine unerlässliche Voraussetzungfür ein gedeihliches Zusammenlebensein. Das bloße Anderssein oder das Leben außerhalb gewohnter Bahnen reichen also nicht aus, denn auch solche Verhaltensweisen sind durch die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG gedeckt. Erforderlich ist ein sozial abträglichesVerhalten, welches das menschliche Miteinander nicht unerheblich beeinträchtigt und Gegenmaßnahmengeradezu zwingendmacht. Dass auch diese Umschreibung im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot nicht völlig befriedigt, liegt auf der Hand.
b) (Nicht-)Anwendungsfälle
33a
Die meisten, früher im Zusammenhang mit der „öffentlichen Ordnung“ genannten Fälle werden heutzutage von der Rechtsordnung erfasst. Zunächst ist also sorgfältig zu prüfen, ob das vorliegende Verhalten oder der bestehende Zustand z. B. gegen Normen des Straf-, des Ordnungswidrigkeitenrechts oder des Verwaltungsrechts verstößt. Ist das der Fall, kann nurdie öffentliche Sicherheit tangiert sein. Nur wenn ein (drohender) Normverstoß nicht festgestellt werden kann, darf ein möglicher Ordnungsverstoß untersucht werden. Bei genauer Auslegung dürfte es jedoch schwer sein, einen Anwendungsfall zu finden. Die folgenden Beispiele sind Belege dafür.
Читать дальше